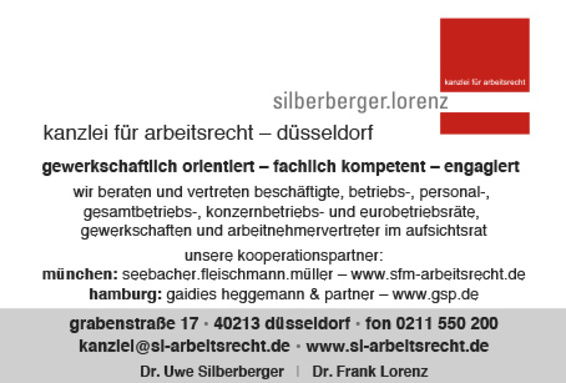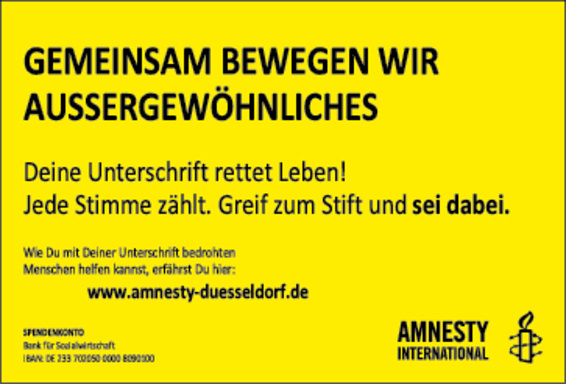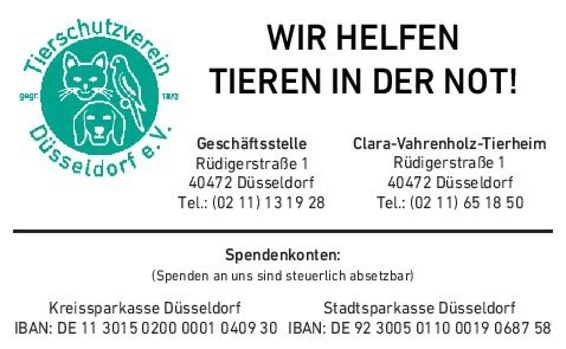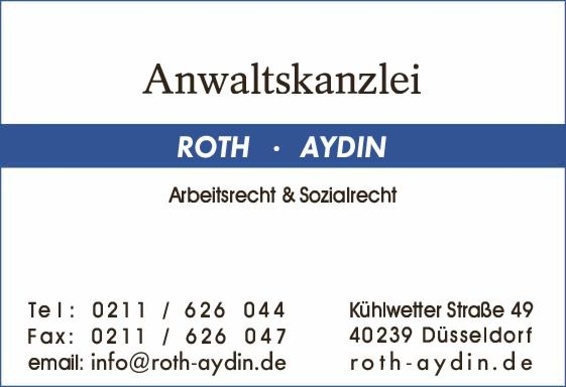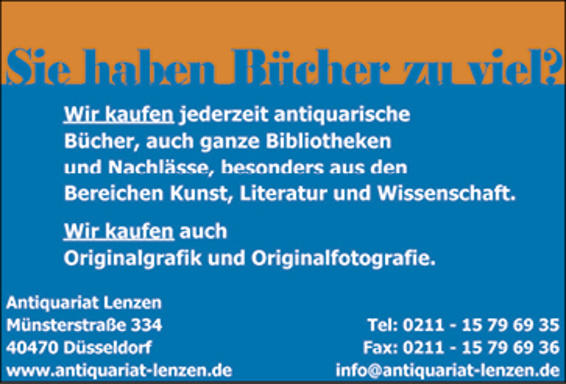Stars der Straße
Würden wir Schönheit erkennen?
Im Jahr 2007 spielte Joshua Bell, einer der bekanntesten Violinisten der Welt, unerkannt als Straßenmusiker in einer U-Bahn-Station in Washington D.C.. Er trug normale Alltagskleidung (Kapuzenjacke, Jeans, Basecap). Er spielte auf seiner Stradivari-Violine, über 10 Millionen Dollar wert. Das Programm bestand aus einigen der anspruchsvollsten klassischen Stücke, z. B. von Bach und Schubert. Nur sehr wenige Menschen blieben stehen, und insgesamt verdiente er etwa 32 Dollar – darunter 20 von einer Frau, die ihn erkannt hatte. Es war ein Experiment der Washington Post, inszeniert vom Journalisten Gene Weingarten, der später dafür sogar den Pulitzer-Preis gewann. Die Frage dahinter war: „Würden Menschen Schönheit erkennen, wenn sie sie außerhalb des gewohnten Rahmens erleben?“

Stargeiger Joshua Bell spielt in einer U-Bahnstation in Washington D.C. Hier selbst ansehen: youtube.de
_________________________
Sie haben keine Bretter, die die Welt bedeuten, keine Scheinwerfer. Ihr Theater ist die Fußgängerzone, ihr Publikum: Passant*innen. Straßenkünstler*innen verwandeln alltägliche, öffentliche Orte in Bühnen – mit nichts als ihrem Talent, ihrem Mut und der Hoffnung, dass jemand stehen bleibt und zuhört oder zuschaut. Doch was wissen wir über sie? Welche Schicksale verbergen sich hinter ihrer Kunst? Noemi Pohl hat sich mit einigen von ihnen unterhalten (und sie bei ihren Darbietungen fotografiert).
Takashi
Ein gewöhnlicher Morgen in der Düsseldorfer Altstadt. Konzentriert, in einem hellgrauen Kimono, steht ein Mann vor dem Eingang zur U-Bahn-Station. Er strahlt eine ganz besondere Ruhe aus. In den Händen hält er ein langes, flaches Instrument: eine Shamisen. Drei Saiten, harter Klang. Vor ihm ein Gitarrenkoffer und ein Schild: „Hallo, ich komme aus Japan und reise um die ganze Welt“. Takashi, 39, aus Okinawa reist seit sechs Jahren. Sein Kapital: das Instrument, sein Gesang und die Freundlichkeit der Menschen. „Als ich Japan verlassen habe, hatte ich nur 100 Euro", erzählt er. Seitdem spielt er sich über den Kontinent: Über Russland und die Mongolei nach Usbekistan ist er schließlich bis Deutschland gereist. Seine wichtigste Begleiterin: die Shamisen, ein traditionelles Instrument aus Okinawa. Das Instrument hat einen unverwechselbaren, klackenden Klang, der durch das harte Plektrum, den Bachi, entsteht. Takashi singt dazu. In alten Dialekten, manchmal improvisiert, manchmal mit leisen, meditativen Tönen. Es ist eine Musik, die aus einer anderen Zeit zu kommen scheint. „Ich komme von einer kleinen Insel, die kaum jemand kennt. Ich möchte den Menschen durch meine Musik etwas von unserer Kultur zeigen”. Kultureller Austausch - für ihn das Wertvollste an seiner Reise: die Menschen, die er kennenlernt, die Kulturen, die Gewohnheiten, das Essen. Takashi schläft auf Campingplätzen, in günstigen Hostels. Noch fünf Jahre will er weiterziehen, einmal jeden Kontinent bereisen, bevor es zurück nach Hause geht.
Die Düsseldorfer Altstadt füllt sich allmählich. Viele Menschen bleiben kurz stehen und lauschen gespannt der Musik eines unbekannten Instruments. Bei Spenden verbeugt Takashi sich leicht, faltet die Hände zum „Gasshō“, dem japanischen Gruß der Achtsamkeit. Dann spielt er weiter.

Takashi schläft auf Campingplätzen, in günstigen Hostels. Noch fünf Jahre will er weiterziehen, einmal jeden Kontinent bereisen.
Lu
Während Takashis meditative Klänge die Morgenstunden begleiten, dröhnt an der Inneren Kanalstraße in Köln der Großstadt-Lärm. Hunderte von Autos überqueren hier täglich die Kreuzung. Müde Gesichter hinter Windschutzscheiben, Kaffee-Becher in den Mittelkonsolen. Hektik auf dem Weg zur Arbeit. Ampel grün, Ampel rot. Der Verkehr gerät hier oft ins Stocken. Ampel rot: Mit drei Bällen und einem Lächeln betritt Lu, 27, die Fahrbahn. Er trägt eine rote Perücke und eine Clownsnase. Lu hat genau 45 Sekunden - so lange dauert die Rotphase. Dann fliegen die Bälle durch die Luft, wechseln die Richtung, tanzen zwischen den Händen. Ein paar Autofahrer*innen zücken ihre Handys, andere blicken genervt zur Seite. Bevor die Ampel umschaltet, hat Lu die Fahrbahn längst wieder verlassen und geht an seinem Publikum vorbei. Einige kramen nach Kleingeld. Manchmal gibt’s einen Euro, manchmal ein Lächeln, manchmal gar nichts. Ampel grün: Dann fahren sie weiter. Und Lu wartet auf die nächste rote Ampel - das ist seine eigene Zeitrechnung. Lu lebt, wie er auftritt: leichtfüßig, aber präzise. Seit sieben Jahren reist er um die Welt, zieht durch die Städte, schläft mal hier, mal dort. Ursprünglich kommt er - das sagt er selbst - „from the future.“ Und wenn er gerade nicht aus der Zukunft kommt? „Then I’m from the past.“ Aus jeder Gelegenheit macht der Kolumbianer einen Auftritt. Für ihn ist Straßenkunst mehr als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen: „Straßenkunst bedeutet für mich Freiheit. Lebenszeit. Bewegung. Ich brauche keinen festen Job. Ich will reisen und mich bewegen. Die Straße ist meine Bühne“. Lu ist Psychologe und Filmemacher, das Jonglieren hat er auf der Straße gelernt - von anderen Reisenden, von Freund*innen. Über die Zeit hat er seinen ganz eigenen Stil entwickelt: „I do the ridiculous in a very unique way“ (Ich mache Komik auf meine ganz eigene Art), so Lu. Darin findet er seine größte Erfüllung, auch wenn es nicht immer einfach ist. Das Schwierigste am Leben als Straßenkünstler sei „vor allem ich selbst“, sagt er. „Nicht aus meinem innerem Frieden und meiner guter Laune herauszufallen. Auch, wenn man oft ein Nein hört“. Doch das positive Feedback überwiegt: „Wenn jemand wegen meiner Kunst lächelt, ist das für mich das Allerschönste.“

Lu ist Psychologe und Filmemacher, das Jonglieren hat er auf der Straße gelernt - von anderen Reisenden, von Freund*innen.
Andreas
Während Lu und Takashi einzeln auftreten, setzen andere auf die Kraft der großen Show. Auf dem Aachener Marktplatz tummeln sich die Menschen. Spannung liegt in der Luft, neugierige Blicke, Fragen. Was passiert jetzt? Inmitten der Menge: zwei Männer im Anzug mit Hornbrille, Stapelstühlen und einem Hoch-Einrad. Alle Blicke sind auf sie gerichtet. Die Menschen bleiben stehen, beobachten neugierig das Geschehen und warten ab, was als Nächstes passiert. Langsam schließt sich der Kreis aus über 500 Menschen - die Show beginnt: Eine Mischung aus Artistik und Komik. „Wall Street Theatre” nennt sich das Duo von Andreas und Christian. Ihre Show ist fein abgestimmt, gleichzeitig offen für alles, was passiert. „Straße ist immer verbunden mit Freiheit. Straße ist Anarchie“, sagt Andreas. Was die Straße einzigartig macht? „Diese Momente, die nur jetzt existieren. Wenn ein Fahrrad durch den Kreis fährt, dann ist das nicht schlimm, sondern eine Einladung, es einzubauen." Andreas und sein Kollege liefern eine Show mit mehreren kleinen Gimmicks, ein Abschluss-Act am Ende. Jonglage, weiße Stapelstühle, Hoch-Einrad. Hunderte von Menschen, die durch die Stadt schlendern wollten, werden spontan zu ihrem Publikum - und sogar selbst zum Star der Show: Am Ende steigt Andreas auf die Schultern eines Freiwilligen und jongliert. Alle klatschen, das Duo geht mit einem Hut rum, viele geben Geld. Das Besondere: Das Publikum kann jederzeit einsteigen. „Diese Momente, wo alle wissen: Das hier ist nur jetzt - das ist das Schönste. Für die Leute ist das einmalig“, so Andreas. Hinter dieser Spontanität stecken über 30 Jahre Erfahrung und eine Ausbildung in Bristol - seit er 16 ist, spielt Andreas Theater. Zunächst ohne die Absicht, damit Geld zu verdienen. Später wird er vor allem für Festivals gebucht, die Straßenauftritte macht er dann nur noch zum Spaß. „Die Straße ist viel unberechenbarer als eine Bühne, du musst dich viel interessanter machen“, erklärt er. „Aber man ist eben auch viel freier.” Für ihn bedeutet Glück: „Du gehst ins Eiscafé, zählst dein Geld, isst ein Eis. Und weißt: du hast dir das gerade erspielt.“
Doch: Reglementierungen, Genehmigungen, Regeln erschweren das spontane Spiel. Manche Städte verlangen Anträge Wochen im Voraus, andere dulden nur bestimmte Zeiten. Bis 22 Uhr darf gespielt werden, danach droht ein Platzverweis. „Für mich ist ein Straßenauftritt etwas sehr Freies“, so Andreas „Aber das kannst du dem Finanzamt nicht erklären“.
Vor zwei Jahren hat Andreas aufgehört als Künstler zu arbeiten: Zu oft sei es finanziell eng gewesen für die Familie. Und: „Ich hatte keine Lust mehr, ständig das Wochenende zu belegen und einen völlig anderen Rhythmus zu haben als meine Frau und meine Kinder“, sagt er. „Nach 30 Jahren habe ich mich nach einer Struktur gesehnt“. Seitdem arbeitet Andreas im IT-Bereich.

Andreas und sein Kollege liefern eine Show mit mehreren kleinen Gimmicks, ein Abschluss-Act am Ende. Jonglage, weiße Stapelstühle, Hoch-Einrad.
Max
Während Andreas am Ende einen geregelten Rhythmus für sein Leben schätzen lernte, sucht Max das Gegenteil: Freiheit, Offenheit, Spontanität. „Die Leute auf der Straße nehmen dich so, wie du bist. Es ist die natürlichste Art und Weise, Musik zu machen", findet er. Der 35-Jährige hat Physik studiert und an einer Gesamtschule gearbeitet. Nebenbei ist er schon immer seiner großen Leidenschaft nachgegangen: Musik machen. Seit er 18 Jahre alt ist, macht er mehrmals die Woche auf den Straßen von Köln und im Umland Straßenmusik. Irgendwann wurde ihm klar: „Genau das möchte ich machen. Davon leben, um die Welt reisen." Er kündigte, macht nur noch Musik und reist mit seiner Gitarre durch Europa: „Ich bin da raus. Heute lerne ich Menschen kennen, denen ich in meiner alten Welt nie begegnet wäre." Wenn er auf der Straße spielt, trifft er auf Professor*innen, Drogenabhängige, Tourist*innen, Kinder, Rentner*innen. „Man kommt aus seiner Bubble raus und das macht was mit einem." Besonders prägend waren für ihn Begegnungen mit Wohnungslosen. „In Brühl habe ich ein paar richtige Fans. Wohnungslose, die mir zuhören, mir Pizza kaufen, mehr Geld geben als andere", sagt er und lacht. „Mit solchen Menschen komme ich sonst nie in Kontakt“. Heute verdient Max an guten Tagen 100 bis 200 Euro. Er lebt auf dem Land - Köln wäre zu teuer, zu voll, zu zielgerichtet. „Wenn ich da wohnen würde, müsste ich in dieses Karrieredenken zurück. Das würde mein Profil total verändern. Ich will rumreisen und Musik machen. Punkt.“ Das Leben, das er führt, will er nicht eintauschen. „Ich mache Musik für mich. Wenn's anderen gefällt - umso besser."

Max hat Physik studiert und an einer Gesamtschule gearbeitet. Nun liebt er die Freiheit als Straßenkünstler.
Valeria
Max sowie all die anderen reisen freiwillig - Valeria blieb kaum eine andere Wahl. Nicht weit entfernt von Takashis morgendlichem Auftrittsplatz sitzt vor dem H&M eine Musikerin mit ihrer eigenen Geschichte. Valeria ist 27 und kommt aus der Ukraine. Seit 2024 ist sie hier, geflohen vor dem Krieg, kommt ursprünglich aus Cherson, einer Stadt im Süden, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder unter Beschuss stand. Dort hat sie am Konservatorium Musik studiert, als Model gearbeitet und bei H&M gejobbt. Heute ist sie arbeitslos und wartet auf ihren Platz im Sprachkurs. Bis dahin spielt sie auf den Straßen von Düsseldorf, Köln und Umgebung Musik auf ihrer Bandura, dem ukrainischen Nationalinstrument. „Wie lange dauert das Interview?” fragt sie, als ich ihr Fragen zu ihrer Musik stelle. Sie weiß, dass ihre Zeit zum Spielen begrenzt ist: Es ist immer nur in der letzten halben Stunde einer Zeitstunde erlaubt zu spielen. Pünktlich muss sie ihren Platz geräumt haben, sonst gibt es Probleme mit dem Ordnungsamt. Und Valeria möchte ihre Zeit nutzen. Mindestens dreimal die Woche fährt sie aus Mönchengladbach her, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Wir kriegen Geld vom Jobcenter, aber das reicht oft nicht." Ihr Freund übersetzt aus dem Ukrainischen. Auf der Bandura spielt Valeria traditionelle ukrainische Lieder und begleitet sie mit ihrem Gesang - ein Gefühl, das sie in Erinnerungen an ihre Heimat schwelgen lässt. „Das Schönste am Straßenmusikmachen ist für mich, wenn andere ukrainische Menschen vorbeikommen. Oft bleiben sie stehen, hören mir zu. Manche singen mit oder fangen sogar an zu weinen”, erzählt Valeria. „Wenn jemand plötzlich ein Lied aus seiner Heimat hört, das geht direkt ins Herz. Manche sagen: „Das ist wie Zuhause. Ich vergesse kurz den Krieg.” Sobald der Krieg vorbei ist, möchte Valeria zurück in ihre Heimat. Bis dahin hält sie sich an den kleinen Momenten fest: ein ukrainisches Lied, eine Frau, die innehält und plötzlich nicht mehr in Düsseldorf steht, sondern in Kyjiw oder Cherson - nur für ein paar Minuten. „Es ist ein empowerndes Gefühl, wenn ich sehe, dass Menschen sich erinnern und sich freuen. Es ist nicht nur Musik. Es ist Verbindung.“

Valeria stammt aus Cherson. Dort hat sie am Konservatorium Musik studiert. Der Krieg hat sie nach Deutschland gebracht. Doch sie hat Heimweh und mit ihrer Musik fliegt ihre Seele manchmal nach Hause.
Von Takashis meditativer Shamisen über Lus jonglierendes Schauspiel bis zu Valerias heimatverbundener Bandura - die Straße wird zur Bühne für Menschen aus aller Welt. Die meisten Künstler*innen suchen nicht primär das Geld, sondern das Gefühl absoluter Freiheit - jederzeit aufhören oder weitermachen zu können, ohne Chef*in, ohne feste Zeiten, nur mit sich selbst und der eigenen Kunst. Ihre Geschichten zeigen: Straßenkunst ist mehr als Unterhaltung. Straßenkunst ist Verbindung. Sie ist Anarchie. Vielseitigkeit und Selbstverwirklichung. Straßenkunst ist Bewegung und Lebenszeit. Bleiben wir stehen. Erkennen wir Schönheit.