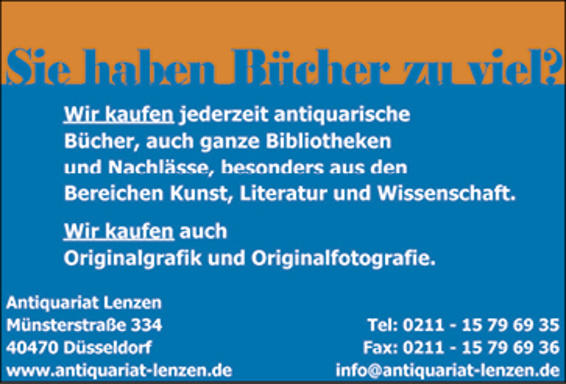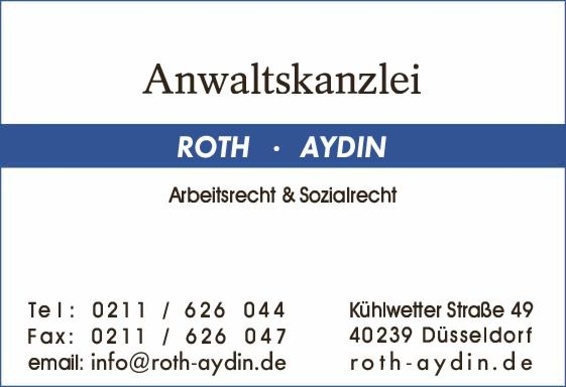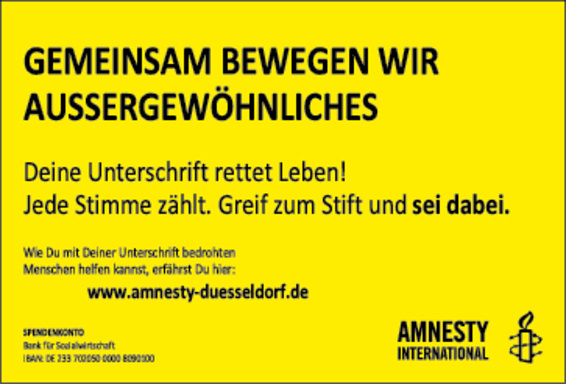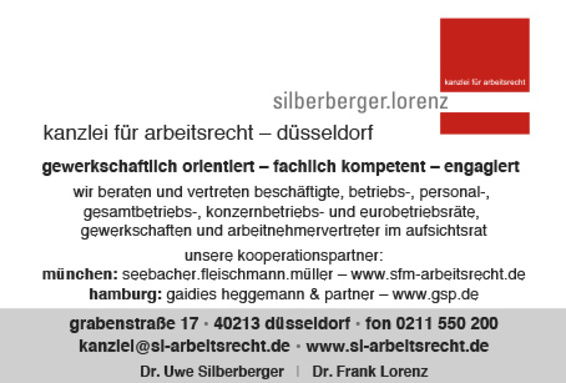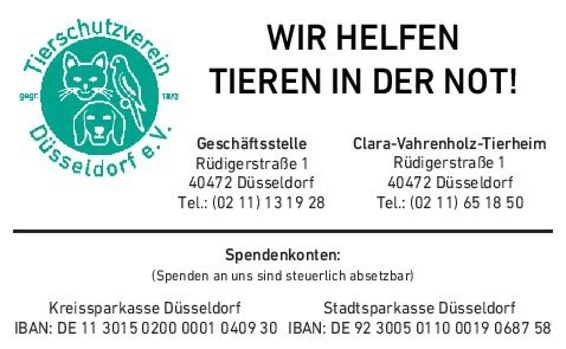Menschen: Hans Christian Andersen
„Das Leben ist das schönste Märchen, denn darin kommen wir selber vor.“
In seiner Autobiographie Das Märchen meines Lebens (1855) fasst der fünfzigjährige Hans Christian Andersen seinen Lebenslauf folgendermaßen zusammen: „Mein Leben ist ein hübsches Märchen, ebenso reich wie glücklich. Wäre mir, da ich als Knabe arm und allein in die Welt hinausging, eine mächtige Fee begegnet und hätte gefragt: 'wähle deine Laufbahn und dein Ziel, und dann beschütze und führe ich dich je nach deiner Geistesentwickelung und wie es der Vernunft gemäß in dieser Welt sein muss!'– mein Schicksal hätte nicht glücklicher und besser geleitet werden können.“ In der Tat mutet sein Lebenslauf märchenhaft an. 1805 als Sohn eines verarmten Schuhmachers und einer alkoholkranken Wäscherin in der Stadt Odense auf der dänischen Insel Fünen geboren, machte sich der künstlerisch interessierte und begabte Junge im Alter von 14 Jahren völlig mittellos auf den Weg nach Kopenhagen, wo er es auf steinigem Weg zum weltberühmten Künstler brachte.
Entscheidenden Anteil daran hatten seine Kunstmärchen. Früh hatte er bemerkt, welche Möglichkeiten sich ihm mit diesem Genre auftaten, nicht nur für Kinder, sondern erst recht auch Erwachsenen gegenüber: „Die Märchendichtung ist das am weitesten ausgedehnte Reich der Poesie“, schreibt er, hier kann er alles hineinlegen, „das Tragische, das Komische, das Naive, die Ironie und den Humor.“ An seinen Dichter-Freund R. S. Ingemann schreibt er: „Ich erzähle den Kindern, während ich daran denke, dass Vater und Mutter oft zuhören, und ihnen muss man etwas für den Verstand geben.“ Seine Stoffe und Motive fand Andersen in der Regel nicht in tradierten Volksmärchen, wie etwa die Brüder Grimm, sondern in alltäglichen Dingen, vor allem in der Natur, wie aus einem Bericht seiner Bewunderin Annie Wood hervorgeht, die ihn einmal auf einem Spaziergang begleitete: „In der Kühle des Nachmittags machte er gern Spaziergänge durch Wiesen und Felder. Die erste Viertelstunde sagte er nicht viel, schlenderte den Weg entlang, stocherte mit seinem Spazierstock in jedem Winkel herum oder berührte damit alles mögliche, das er auf dem Weg liegen sah. Dann erregte irgendetwas seine Aufmerksamkeit – ein Stückchen Glas, eine verwelkte Blume oder die Überreste eines Insekts -, was immer es war, er hob es auf , berührte es sanft, beugte sich liebevoll darüber und begann dann mit leiser, fast bekümmerter Stimme von der Lebensgeschichte dieses Gegenstandes zu erzählen, von seinen Freuden und Leiden und dem traurigen Los, das ihn dorthin brachte, wo er ihn gefunden hatte.“ Dass überdies die Entbehrungen seiner Kindheit Andersen Motive für viele seiner Märchen lieferten, ist häufig dargelegt worden. So schrieb er 1869 in einem Brief an Georg Brandes über das Märchen Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, dies sei eine „Abspielung“ seines eigenen Lebens. Hans Christian Andersen hat die Stigmatisierung und Traumata seines abenteuerlichen Lebens in Kunst verwandelt. So wurde der Exzentriker und Außenseiter zu einem der weltliterarisch wirkungsmächtigsten Dichter seiner Zeit.
Als Hans Christian Andersen vor 150 Jahren, am 4. August 1875 siebzigjährig an Leberkrebs starb, hinterließ er ein riesiges Konvolut an Werken unterschiedlichster Gattungen. Der Literaturwissenschaftler und Andersen-Biograph Heinrich Detering zählt 156 Märchen, sieben Romane und sechs Reisebücher, mehrere Autobiographien, annähernd vierzig Schauspiele und Vaudevilles, über 800 Gedichte und Lieder, seine im Druck zwölf Bände umfassenden Tagebücher sowie ungezählte Scherenschnitte, Collagen und umfangreiche Bilderbücher. Ein gewaltiges Oeuvre, das längst nicht ausgeschöpft ist. Deterings Kommentar trifft es gut: „Joan Baez schrieb einmal über Bob Dylan, dass sich noch in seinen schlampigsten Werken sein Genie zeige. Das darf man mit Fug und Recht auch über das gewaltige Schaffen von Hans Christian Andersen sagen.“
Hans Peter Heinrich