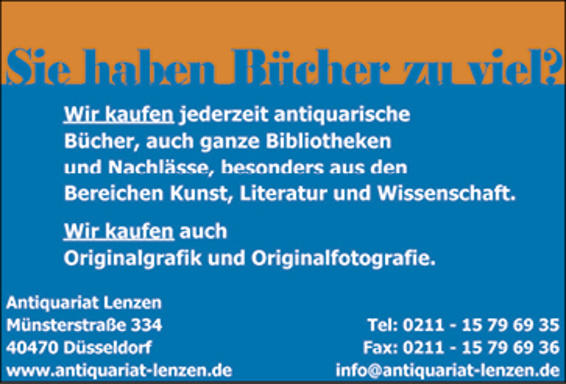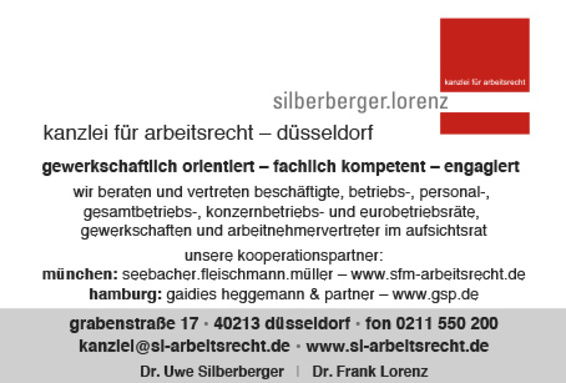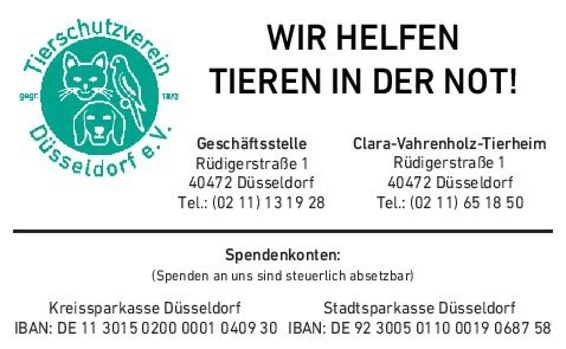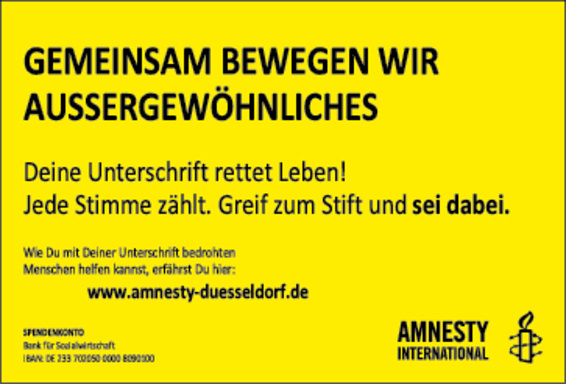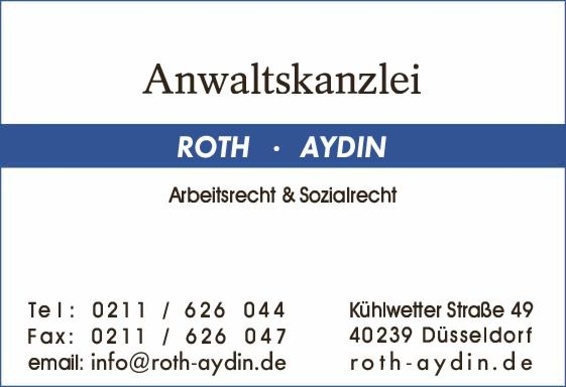Kultur
Duisburg
Mechanik und Menschlichkeit
(oc). Nur noch wenige Wochen, dann verlassen Jean Tinguelys kinetische Figuren wieder das Lehmbruck Museum (bis auf die im Besitz des Hauses befindlichen) und entfleuchen Eva Aepplis Hexen und anderen unheimlichen Handpuppen, denn dann endet die großartige, in ihrer Konstellation einmalige Ausstellung Mechanik und Menschlichkeit mit Werken des zeitweiligen Schweizer Künstlerpaars. Tinguely und Aeppli, beide im Mai 1925 geboren, lernten sich auf der Basler Kunstgewerbeschule kennen und gingen in den 50er Jahren nach Paris. Dann trennten sich ihre Wege, aber ab 1990 fanden sie noch einmal kongenial zusammen – seine skurrilen Maschinen setzten nun ihre abgründigen Puppenwesen in Bewegung, Aepplis Ernst und Tinguelys Verspieltheit verbanden sich zu neuen Synergien. Genau das führt die Duisburger Schau vor. Also nutzen Sie noch die Gelegenheit, betätigen Sie die Fußschalter all der wundersamen Räderwerke und suchen Sie Ihren Weg zwischen Schmunzeln und Melancholie.
Bis 24. 8. im Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilhelm-Str. 40, 47051 Duisburg; lehmbruckmuseum.de

Vorsicht, der Museumsführer ist geladen! Foto: Anne Orthen
Düsseldorf
Schlecht gelaunt durchs Museum
(oc). Der Kunstpalast Düsseldorf beschäftigt neuerdings einen Grumpy Guide, also einen betont mürrischen, missgelaunten Museumsführer. Er mutet den Besucher*innen einen höchst exzentrischen Parcours durch die Sammlung des Hauses zu, kanzelt hier einen uninformierten Gast ab, lästert da über ein ehrwürdiges Werk oder die unfähige Direktion des Musentempels – und stets sind seine Führungen ausverkauft, denn die Leute haben ihren Spaß am Unernst, mit dem der grantelnde Kunsthistoriker Joseph Langelinck die akademische Heiligkeit des Museums unterläuft. Angeblich ist er Nachfahre eines früheren Direktors der Galerie. In Wirklichkeit verbirgt sich hinter der Figur der Düsseldorfer Komödiant Carl Brandi. Es darf also gelacht werden im Ehrenhof. Man kennt den neuen Trend ja bereits von kabarettistisch betreuten Sinfoniekonzerten oder Restaurants mit ausgesucht ruppigen Kellnern. Unerschöpflich scheinen die Wege der Spaßgesellschaft.
Nächste Termine u. a.: 16. 8./6. 9./18. 10./15. 11./13. 12. jeweils 16 Uhr, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf, kunstpalast.de

Bruno Ganz in „Der Himmel über Berlin“ von Wim Wenders © Road Movies – Argos Films
Bonn
Wenders oder Die Kunst des Sehens
(oc). Im August begeht der Regisseur und Fotograf Wilhelm Ernst „Wim“ Wenders seinen 80. Geburtstag. Die Bundeskunsthalle Bonn widmet dem gebürtigen Düsseldorfer unter dem Titel W.I.M. – Die Kunst des Sehens eine große Ausstellung. Wenders begann sich in den 1970er Jahren mit Filmen wie Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (nach Peter Handke) und Der amerikanische Freund (nach Patricia Highsmith) einen Namen zu machen. Weitere Meilensteine waren Paris, Texas und Der Himmel über Berlin. Der Musikfilm Buena Vista Social Club brachte Wenders eine Oscar-Nominierung und den Europäischen Filmpreis ein. In jüngerer Zeit entstanden Künstlerporträts wie Pina, Das Salz der Erde und Anselm – Das Rauschen der Zeit. In Bonn sind außer umfangreichen Filmkompilationen – etwa in einer eigens konzipierten Rauminstallation – auch Fotoarbeiten, Zeichnungen, Drehbücher und vieles mehr zu sehen. Und Wenders führt selbst durch die Schau – jedenfalls akustisch per Audiowalk.
1. 8. 2025 bis 11. 1. 2026, Bundeskunsthalle, Museumsmeile Bonn, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Trügerische Idylle: Ginsterburg. Ausschnitt aus dem Buchcover.
Neuss, Meerbusch
Und Rühmann spielt dazu
(oc). Nach der Machtergreifung ist in Ginsterburg ein neuer Alltag eingekehrt. Der junge Lothar träumt vom Fliegen, und das treibt in direkt in die Arme der Hitlerjugend. Seine Mutter kann da nur ohnmächtig zusehen. Auch ihre Buchhandlung schützt sie nicht vor den neuen Zumutungen. Und während die einen verstummen und einige sich langsam korrumpieren lassen, nutzen andere forsch die neuen Verhältnisse zu ihren Gunsten. Dem Blumenhändler, dem Fabrikanten, dem Arzt öffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Derweil spielt im Lichtspielhaus weiter Heinz Rühmann und über den Nürburgring jagen die Silberpfeile. Doch allmählich rückt auch der an fernen Fronten geschlagene Krieg näher. – Arno Franks großer Roman Ginsterburg hat die Kritik überzeugt und beeindruckt. Ihm „gelingt es“, heißt es etwa in der SZ, „die viel beschriebene, aber selten begriffene Banalität des Bösen erfahrbar zu machen.“ Im Rahmen des Literarischen Sommers liest Frank in Neuss und Meerbusch.
20. 8. Stadtbibliothek Neuss, 21. 8. Stadtbibliothek Meerbusch, jeweils 19 Uhr; literarischer-sommer.eu
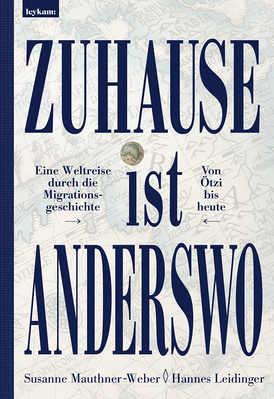
Sachbuch
Wir sind die Anderen
(hph). Ötzi, der mumifizierte Mann vom Tisenjoch in den Ötztaler Alpen, lebte vor etwa 5.300 Jahren. Lange Zeit als der „Ur-Österreicher“ betrachtet, wies eine Genanalyse aus dem Jahr 2023 jedoch nach, dass sein Erbgut zu 91 Prozent mit jenem der frühen europäischen Ackerbauern Anatoliens übereinstimmt. Das bedeutet: Ötzi stammte von Einwanderern aus der heutigen Türkei ab. Die Wissenschaftsjournalistin Susanne Mauthner-Weber und der Historiker Hannes Leidinger zeigen in ihrer Weltreise durch die Migrationsgeschichte, dass Migration seit jeher Teil der Menschheitsgeschichte ist. Schon unsere frühen Vorfahren haben ihre Heimat in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen verlassen. Vom Erbauer Stonehenges bis zu den Integrationsproblemen des Goten Alarich in Rom, von den Vertreibungen des Konfessionszeitalters bis zu den Europäer*innen, die in großer Zahl in alle Welt auswanderten: Jede Geschichte erzählt von den individuellen Schicksalen und Herausforderungen der historischen Migrant*innen. Bei der Auswahl der Beispiele wurde darauf geachtet, dass sich unterschiedliche Motive für Migration widerspiegeln. „Menschen, die die Heimat aus Abenteuerlust verlassen haben oder weil wirtschaftlicher Aufstieg lockte, kommen genauso vor wie jene, die wider Willen entwurzelt wurden.“ Die Fluchtursachen klingen vertraut: Vertreibung, Zwangsdeportation infolge politischer wie religiöser Verfolgung und kriegerische Handlungen – noch heute Hauptursachen, Zuflucht und „Heimat anderswo“ zu suchen. Das Buch schlägt immer wieder Brücken zu gegenwärtigen Debatten und macht deutlich, dass, historisch betrachtet, Migration der Normalzustand ist, Sesshaftigkeit hingegen „weitgehend ein Konstrukt – nämlich ein konservatives, nationalistisches, ausschließendes Konstrukt“, so das Resümee. Ein fundierter, hochaktueller Beitrag zu den derzeitigen teils hitzig geführten Debatten zum Thema Migration.
Susanne Mauthner-Weber, Hannes Leidinger: Zuhause ist Anderswo. Eine Weltreise durch die Migrationsgeschichte – von Ötzi bis heute. Leykam Buchverlag, Graz 2024, 256 Seiten, 27 Euro
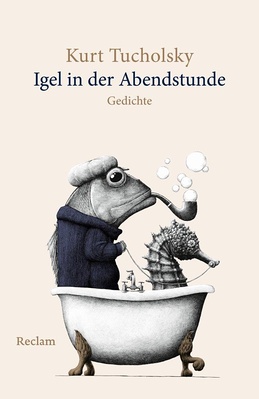
Gedichte
Schnauze mit Herz
(oc). Man könnte meinen, bei Kurt Tucholsky (1890-1935), diesem hochproduktiven Verfasser von Essays, Leitartikeln und Kritiken, der sich vier Pseudonyme zulegte, um im Blätterwald breiter aufgestellt zu sein, sei es mit Gedichten ja wohl nicht so weit her. So kann man sich täuschen. Das wohlsortierte Auswahlbändchen Igel in der Abendstunde, erschienen in einer kleinen Reihe Seit an Seit mit Morgenstern und Ringelnatz (siehe fiftyfifty 6 und 7-2025) beweist es. Und liefert im Nachwort auch Zahlen: Von Tucholskys zwischen 1907 und 1933 entstandenen etwa 2.500 Arbeiten sind rund 800 Gedichte.
Sie pfeifen auf den salbungsvollen Ton und bleiben nah am – liebevoll beobachteten – Alltag und seiner Sprache. Dennoch kommen dabei nie platte Witze und Banalitäten heraus. Denn sie sind auf eine federleichte Art lebensklug und haben Herz. Herz und Schnauze – immer beides. Schon auf den ersten Seiten erwischen eine*n diese Tucho-Momente: Wenn etwa im Gedicht Gefühle seltsam vertraute Gemütszustände aufsteigen: „Das gehört ja alles gar nicht mir …/Ich bin nur vorübergehend hier.“ Oder in Media in vita der Schlusssatz fällt: „Sterben ist, wie wenn man einen Löffel aus dem Kleister zieht.“
Am besten, man liest sich diese Gedichte (wie eigentlich alle) laut vor. So erwacht ihr Rhythmus, ihre Finessen werden deutlicher und man merkt, wie sorgfältig sie gearbeitet sind – ob im fetzenfliegenden Ehekrach, ob im Lamento des ewig unverstandenen deutschen Mannes oder bei Tucholskys leider unverändert aktueller Frage An das Publikum: „sag mal: bist du wirklich so dumm?“ Hundert kleine Seiten voll geistiger Vitaminstöße und Abwehrstoffe.
Kurt Tucholsky: Igel in der Abendstunde. Gedichte. Hrsg. von Stella Morgen, Reclams Universal-Bibliothek Nr. 14481, 103 Seiten, 7 Euro
Wörtlich
„Du kannst nicht über den Tellerrand gucken, wenn du die Suppe bist.“
Nils Heinrich, Kabarettist, derzeit unterwegs mit seinem Programm „Junger Gebrauchter“