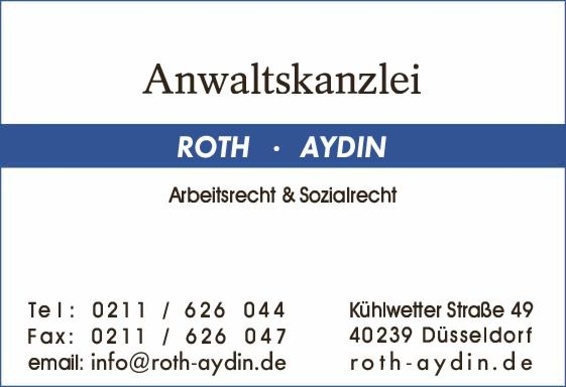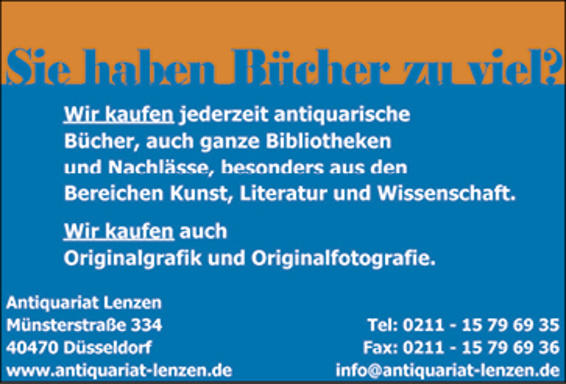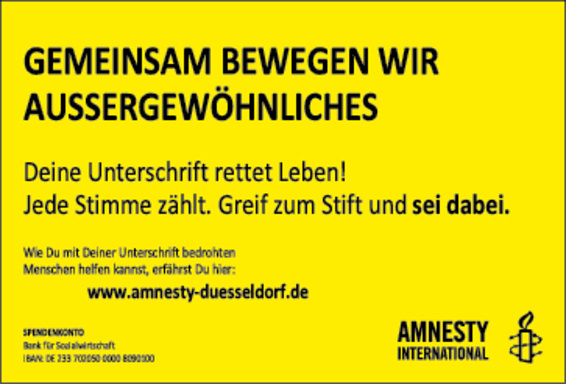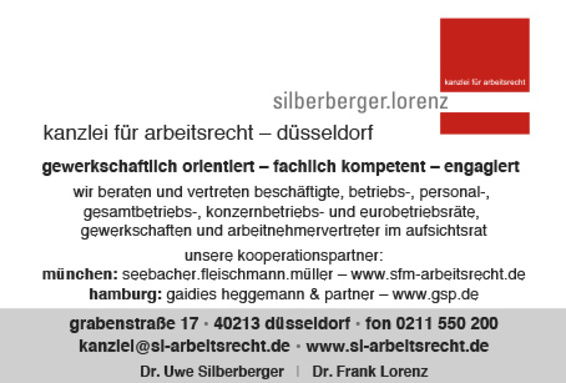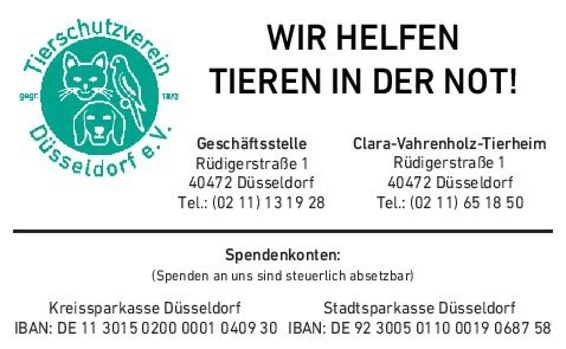Ein Streik anno 1901 in der Gerresheimer Glashütte. Ein italienischer Leutnant in ukrainischen Filzstiefeln. Ein gleißendes Licht über Hiroshima. Drei Buchempfehlungen
Als den Glasmachern die Puste ausging
Bis ins Jahr 2005 war die Gerresheimer Glashütte in Düsseldorf in Betrieb. Neben einigen Industriedenkmälern stehen da immer noch die kleinen Häuschen der Arbeitersiedlung, in denen Glasmacher mit ihren Familien lebten, im Garten Gemüse anbauten und Kaninchen, Hühner, manchmal Schweine oder Tauben hielten.
Der Roman Tage aus Glas führt uns in die Zeit um 1900 zurück. Dorothee Krings beschreibt die Arbeit in der Fabrik, wo die „Püster“ aus voller Lunge Flaschen bliesen, die „Einleger“ vor den Öfen das Material für das Glas hineinschaufelten, alles in Gluthitze und Aschestaub. Und sie schildert das harte Leben der Arbeiterfrauen und ihrer Kinder im Glasmacherviertel.
Eine der beiden Protagonistinnen ist das Mädchen Bille. Nach der Arbeit in einer Weberei, wo ihr der Direktor nachstellt, muss Bille ihrer Mutter helfen, einer schwermütigen Frau, zermürbt von der Schufterei im Haushalt: Kochen, Waschen, Holz holen, Garten und Hühner versorgen. Erst als der junge Glasmacher Adam Bille ausmalt, wie sie zusammen in Amerika ein neues Leben beginnen würden, erhellt Hoffnung Billes düstere Tage.
Hoffnung auf ein anderes Leben hegt auch Leonie, die Tochter des Werksarztes, die von einer ungeliebten Tante in strengen Konventionen erzogen wird. Fasziniert ist sie von den Künstlern, die im Salon des Schuldirektors verkehren; sie spielt Geige und sieht in der Kunst einen Fluchtweg.
Dorothee Krings bildet in ihrem Roman zwei parallele Milieus ab: das Leben der Direktoren, die oben am Hang wohnen, und das Leben der Arbeiterfamilien unten im Rauch der Fabrikschlote. Sie erzählt geradlinig und einfach, gestützt auf umfangreiche Recherchen. Teile der Handlung sowie die Figuren sind erfunden, historisch ist jedoch der Generalstreik der deutschen Glasmacher im Jahr 1901, dem sich die Gerresheimer Arbeiter anschlossen – mit schwerwiegenden Folgen. Sie wurden durch Arbeiter aus Polen und Russland ersetzt, aus ihren Häusern und Wohnheimen geworfen, manche mussten in selbst gebauten Hütten im Wald leben, viele hungerten.
Im Winter fiel der Streik in sich zusammen. Die Direktion der Glashütte hatte keinen Grund, den Forderungen der Beschäftigten nachzugeben, denn die Maschinen, die sie ersetzen würden, waren schon patentiert und in den USA bestellt. Der von vornherein aussichtslose Streik riss Familien auseinander, zerstörte Pläne von jungen Menschen und zementierte die Klassenverhältnisse.
Besonders beeindruckt, wie Dorothee Krings die beiden Milieus auch im Denken schildert. Der Werksarzt ist den Arbeitern, die zu ihm in die Praxis kommen, durchaus zugetan, dennoch ist er überzeugt, dass diese „niederen Leute“ keine geistigen Fähigkeiten besitzen. Seine Tochter Leonie plappert es ihm nach und hält dem fortschrittlichen Künstler, der Kunstkurse für Arbeiterkinder abhalten will, entgegen: „Kaum eins dieser Kinder wird jemals auf einem Schaukelpferd sitzen oder ein Bilderbuch bekommen, aber sie haben dafür auch keinen Sinn“.
Eva Pfister
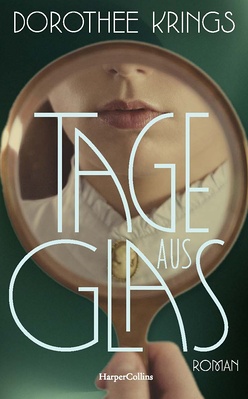
Dorothee Krings: Tage aus Glas, Roman, Harper Collins 2025, 304 Seiten, Hardcover, 24 Euro. – Im September liest die Autorin aus ihrem Buch in Düsseldorf, Kaarst, Duisburg, Willich, Wuppertal und Petershagen. Nähere Infos unter dorotheekrings.de
Warum, Papa?
Selten habe ich ein Buch gelesen, das mich intellektuell und emotional gleichermaßen stark anspricht. Die Autorin, Jahrgang 1964, spricht hier mit ihrem toten Vater, dem klugen Journalisten, dem einfühlsamen und liebevollen Vater, dem ehemals überzeugten „anständigen Faschisten“, der einige Jahre „in Russland“ auf Seiten der Besatzungs-Armee Mussolinis gekämpft hat. Sie will verstehen, warum und wie er im „Krieg gegen Russland, der in Wahrheit ein Krieg gegen die Ukraine war“, gekämpft und was er erlebt hat.
Aus ihren Recherchen zur Geschichte des „lieben Papas“ erfahren wir bis zur Grenze des Aushaltbaren Details – über die Brutalität und Gemeinheit der Besatzer „Russlands“, d. h. der Ukraine. Wir lesen auch, dass die schlimmste Gefahr im Winterkrieg die titelgebenden „kalten Füße“ und die „verbrecherische“ schlechte Ausrüstung der kämpfenden Alpini waren. Nur die zufällig „gefundenen“ Walenki, die ukrainischen Filzstiefel, retteten seinerzeit die Truppe von Leutnant Melandri. Wir erfahren auch einiges über die Arroganz und Fühllosigkeit deutscher Wehrmachtsoffiziere gegenüber den italienischen Kameraden sowie über den ungezügelten Sadismus der Besatzer damals – und heute.
Die Autorin Melandri sichtet Familiennarrative, Erzählungen von ehemaligen Weggefährten, (Augenzeugen-)Berichte und Zeitungsartikel. Ihre zweifelnde und zunehmend verzweifelte Frage „Warum, Papa?“ bleibt ohne Antworten, aber auf ihrer Suche danach lernen wir eine Erzählerin kennen, die sachorientiert und zugleich emotional engagiert auf die Ukraine blickt und dabei immer engere Parallelen zwischen der Besetzung der Ukraine durch die faschistischen Streitkräfte und dem heute dort tobenden Krieg zieht. Ihre gleichermaßen präzise und bildreiche Sprache überzeugte die Leserin dabei genauso wie ihre glasklaren Analysen und Begriffsklärungen. Damit nötigt sie gerade kritische Leser*innen, Denkgewohnheiten im Blick auf imperialistische Strukturen zu modifizieren, zumal sie ihre klare Positionierung gegen die „Spezial-Operation“ Russlands und deren inhärenten Kolonialismus überzeugend belegt, ohne die strukturellen Grausamkeiten der „westlichen“ Kolonialmächte zu relativieren.
Die Gräuel, denen die Ukrainer damals und heute ausgeliefert sind, werden ohne Pathos oder Verachtung berichtet und gewinnen gerade dadurch eine kaum auszuhaltende Eindringlichkeit.
Margarete Pohlmann
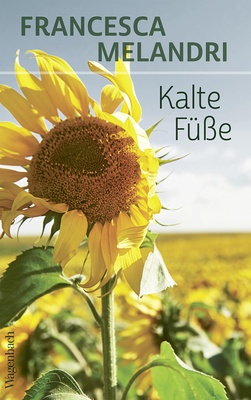
Francesca Melandri: Kalte Füße. Aus dem Italienischen von Esther Hansen. Wagenbach Quartbuch, 288 Seiten, 24 Euro / E-Book 19,99
Es fließt, es fließt, das Licht
Der 6. August 1945 war ein Montag. Der frischgebackene Oberschüler Hisashi Tôhara und seine Kameraden hätten normalerweise eine Arbeitsschicht im nahegelegenen Stahlwerk ableisten müssen, aber dieses war kriegsbedingt von einem stromfreien Tag betroffen. Die Schüler würden also selbst einen freien Tag haben, aus dem Heim in die Stadt ausschwärmen oder ihre Eltern in der Umgebung besuchen können. Hisashi, 18 Jahre alt, und ein Freund nahmen einen frühen Zug, und gerade als der abzufahren schien, geschah wie aus dem Nichts Unfassbares, Unerklärliches, nie zuvor Geschehenes: „Mit einem Mal wurde es um mich herum so hell, dass die Augen geblendet waren. Zeitgleich mit einem Grollen, als würde die Erde sich bewegen, spürte ich einen brennenden Schmerz im Nacken. (…) Es fließt, es fließt, das Licht.“
Augenblicke später dann schwarzer Rauch, tiefste Dunkelheit. Die Fahrgäste stürmen die Zugtüren. Als sich draußen die Schwaden etwas lichten, ist zu erkennen: Alle Häuser ringsum sind eingestürzt, überall schießen Flammen empor. „Ich konnte überhaupt nicht glauben, dass das die Realität war“, notiert Hisashi später. Aber hier und jetzt beginnt erst einmal seine verzweifelte Flucht „barfuß durch Hiroshima“, wie ein anderer, berühmt gewordener Höllenbericht heißt, beginnt sein Überlebenskampf, der auch ein Kampf mit seinem moralischen Gewissen ist, denn überall schreien Menschen herzzerreißend nach Hilfe. Soll er, kann er jetzt diese Hilfe leisten? Mal tut er es, mal nicht und wird sich dessen sein Leben lang schämen: „Ich kann meinen traurigen Selbsthass nicht unterdrücken, wenn mir bewusst wird, dass die Haltung, die in solchen Momenten zum Vorschein kommt, mein wirkliches, unverfälschtes Wesen ist.“
Hisashi entkam dem Feuer, entkam dem Tod durch Ertrinken im Fluss, er sah entsetzliche Szenen, und noch als er das Haus seiner Mutter, zwölf Kilometer vom Zentrum entfernt, erreichte und aus einem langen Erschöpfungsschlaf erwachte, war noch nicht klar, was für eine Waffe das präzedenzlose Inferno entfesselt hatte, in dem fast 100.000 Menschen umgekommen sind, nicht gezählt die vielen späteren Opfer der sogenannten Atombombenkrankheit. Begannen ihnen die Haare auszufallen, wurden sie „sogar von den Ärzten aufgegeben.“
Hisashi Tôhara brachte ein Jahr nach dem Geschehen einen kurzen, bewegenden Bericht zu Papier und versteckte ihn. Seine Frau Mieko fand ihn über 40 Jahre später, ihr Mann war inzwischen gestorben, und erkannte, dass dieses Dokument eine Veröffentlichung wert sei. Heute, 80 Jahre nach den Bombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki, deren kriegsentscheidende Rolle bis heute fraglich geblieben ist, können wir es endlich auch auf Deutsch lesen. Und einmal mehr den Schluss daraus ziehen, dass die Menschheit die Atomwaffen ächten und abschaffen muss. Eine „Sicherheit“, die sich auf sie gründet, bleibt gefährlicher Trug.
Olaf Cless

Hisashi Tôhara: Hiroshima. Eine Stimme aus der Hölle. Aus dem Japanischen von Daniel Jurjew und Anika Koide. Mit einem Nachwort von Daniel Jurjew, Weidle Verlag 2025 (wallstein-verlag.de), 64 Seiten, 16 Euro