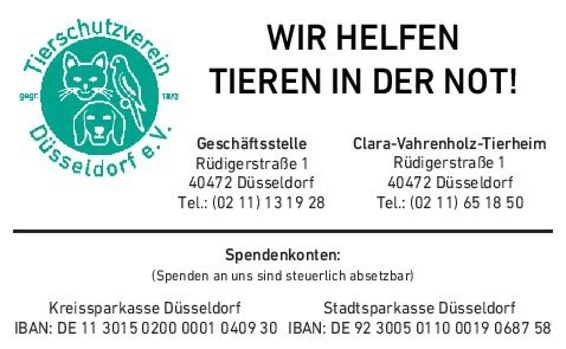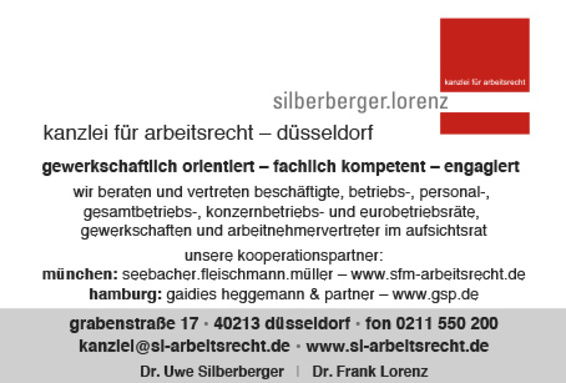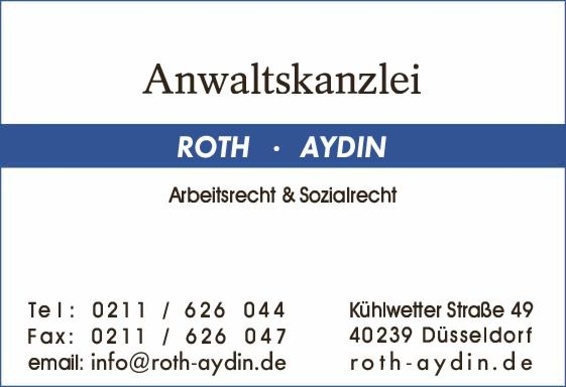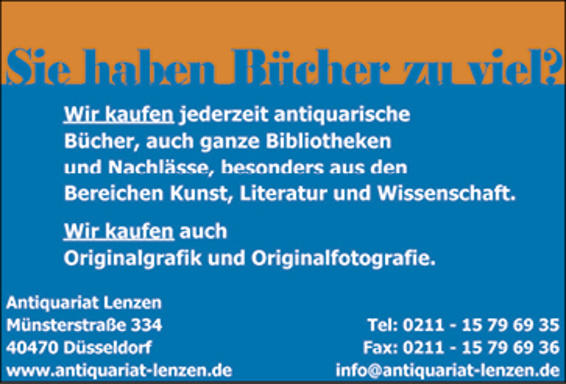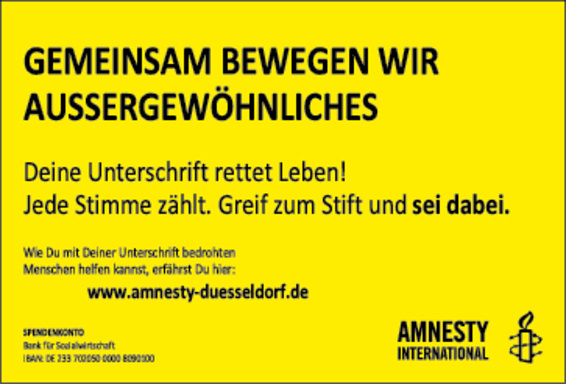Gegen ein Wir welches ein Die Anderen braucht
Schaue ich in die Welt, so mache ich Erfahrungen, die zur Sprache drängen. Und doch weiß ich wieder, was mit einem Satz gemeint war, den ich vor Jahren las. Der Satz, den ich nur aus dem Kopf wiedergeben kann, hatte zum Inhalt, dass sich der Mensch immer dann, wenn er ins Sprechen gerät, der eigenen, unüberwindbaren Verlegenheit stellt. Verlegenheit insofern, als dass es unmöglich ist, die Welt genau so zu erleben, wie die Menschen um uns herum. Es bleibt selbst bei großer Fähigkeit zur Sprache etwas unausgeleuchtet, es wird etwas geben, was unaussprechlich bleibt. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott nannte jene Distanz zwischen Menschen, die sich über Sprache nicht überbrücken lässt: „Incommunicado“. Es gibt etwas an uns und zwischen uns, was nicht kommunizierbar ist.
Für Winnicott war der Ort, der sich in und zwischen Menschen der Sprache entzieht, durchaus etwas Schützenswertes. Und ich bin geneigt ihm zuzustimmen. Denn oftmals ersetzt der Zwang, sich und anderen die Welt zu erklären, den Versuch, sich selbige fühlbar zu machen. Wenn man sich letzteres traut, so stößt man nämlich auf Ungeheuerliches: Widersprüche. Dies beginnt allein schon dann, wenn man sich vornimmt, die Welt zu verändern. Angebote für selbiges gibt es im freien Markt ja zuhauf: Kaufe ich eine Flasche Krombacher, dann pflanze ich einen Baum. Kaufe ich im Bio-Markt ein, so senke ich meinen CO2-Fußabruck. So die Erzählung. Bei genauerem Hinsehen kommt man dann aber in die missliche Lage, erkennen zu müssen, dass sich die Welt von mir allein ganz offenkundig nicht verändern lässt. Das Versprechen der Selbstwirksamkeit bleibt uneingelöst: Ich alleine kann im Grunde nichts tun, was mich verlegen macht. Es ist dieselbe Frustration, die wir vom Sprechen kennen: Am Ende bleibt zwischen mir und der Welt etwas Unüberbrückbares. Ich kann nicht Ich bleiben, wenn ich Du werden will.
An sich ist diese definitive Tatsache etwas Schönes. Im Politischen allerdings stellt uns diese Tatsache vor große Aufgaben, vor allem in Zeiten, in denen die Individualität, die Betonung und das Praktizieren dessen, was uns unterscheidet, oder, im marketingtechnischen Sinne gesprochen „besonders“ macht, allerorts zum Ideal erhoben wird. Der Nachteil dessen lässt sich überall auf brutale Art und Weise bezeugen: Wenn wir, wie es die neoliberale Ikone Margaret Thatcher einst sagte, keine Gesellschaft sind, sondern bloß eine Ansammlung von Individuen, dann fällt die Möglichkeit des Politischen weg, denn das Politische existiert ja nur innerhalb der Möglichkeit, dass es Interessen gibt, die sich ähneln und die damit gebündelt vorgebracht können, für die sich streiten lässt. Von mir allein lässt sich die Welt nicht verändern und für mich allein kann die Welt durch Politik nicht verändert werden. Jetzt könnte man einwerfen: Aber Moment, Parteien wie CDU und FDP machen ja gezielt Politik für den Einzelnen, der Einzelne soll alle Freiheiten haben, soll Reichtum anhäufen können, soll Eigentum besitzen dürfen. Ich würde einwenden, dass wir es hier nicht mit Politik, sondern mit Antipolitik zu tun haben.

(Foto: Berthold Werner)
Wer sich dafür einsetzt, dass Arbeitnehmerrechte aufgeweicht werden, während die Superreichen immer reicher werden, der betreibt etwas, was ich meinem Buch* als „Entpolitisierung“ bezeichnet habe: Es geht um die Zurückdrängung des Politischen, um die Aufkündigung der Tatsache, dass es Schicksale gibt, die sich ähneln. In dieser Welt gibt es nur den Einzelnen, der verdient, was er verdient. Das ist eine Welt maximaler Verlegenheit: Ich und nur ich bin zuständig für mein Schicksal, für das, was mir passiert. Aus einem solchen Erleben der Welt heraus lässt sich kaum in Verbindung treten, denn dann hat nichts von dem, was mir passiert, irgendetwas mit Ihnen zu tun. Wie soll ich Ihnen also dann davon erzählen?
Schaut man sich die epidemische Ausmaße der Einsamkeit an, so sieht man ganz deutlich, dass immer mehr Menschen ein Leben leben, von dem sie denken, dass es mit dem Leben der anderen nicht wirklich etwas zu tun hat. Ein Zustand, der psychisch nachgewiesenermaßen unerträglich ist. Ein Zustand, der zugleich allerdings Aufschluss darüber gibt, warum sich derzeit wieder so viele Menschen in ein Wir flüchten, welches ohne ein Die Anderen nicht auskommt. Der Faschismus findet in einer Welt, in der Schicksale Sache des Einzelnen sind, den perfekten Nährboden. Gerade weil Menschen durch Politik und Talkshows bis zum Erbrechen eingetrichtert wird, dass sie und sie allein Schuld sind an ihrer Misere, wird Tür und Tor geöffnet für eine Ersatzzugehörigkeit, die es vermag, doch noch Schuldige zu finden: Die Migranten, von denen es hierzulande, so sind sich AfD, CDU, FDP und Teile der Grünen und der SPD sehr einig, einfach zu viele in Deutschland gibt.
Nun ist das sicherlich nicht der alleinige Faktor für das Erstarken der faschistischen AfD, aber es ist der Faktor, mit dem ich mich auskenne und über den ich sprechen möchte. Es geht mir dabei auch nicht darum, die Anhänger jener Weltvorstellung in Schutz zu nehmen oder ihnen gar etwas Passives zu unterstellen, im Gegenteil: Wer AfD wählt, tut dies aus Überzeugung. Aber Überzeugungen sind eben das Produkt von Erzählungen über die Welt. Und wenn bestimmte Erzählungen oft genug wiederholt werden, gerade von Akteurinnen und Akteuren, die mal anders über die Welt gesprochen haben, entstehen Überzeugungen, entsteht das Aktive.
Ich mache das folgende keinesfalls leichten Herzens, weil mich die jetzt von mir dargestellten Zitate ganz ehrlich gesprochen fassungslos zurücklassen, aber gerade deswegen stelle ich mich meiner eigenen Verlegenheit und lese sie vor.
1.: „Wer ganz Kalkutta aufnimmt, halb Kalkutta aufnimmt, der hilft nicht Kalkutta, der wird irgendwann wie Kalkutta.“ - Jens Spahn, CDU.
2.: „Das Nazi-Bashing und das Brandmauergerede müssen aufhören.” - Carsten Linnemann, CDU.
3.: „Es darf in Sachen Migration keine Denkverbote geben. Das kann auch sein, dass wir internationales, europäisches oder deutsches Recht ändern müssen. Und wenn es nötig sein sollte, das Grundgesetz zu ändern, sind wir gesprächsbereit.“, - Christian Lindner, FDP.
4.: „Nichtdeutsche Gefährder und Schwerkriminelle sollen konsequent abgeschoben werden.“ - Robert Habeck, die Grünen.
5.: „Wir werden im großen Stile abschieben.“ - Olaf Scholz, SPD.
Alle fünf Aussagen vermitteln, in manchen Fällen hölzerner vorgetragen, als in anderen, doch eine Kernerzählung: Die Sicherheit der Deutschen, was auch immer das heißen mag, hat eine andere Wertigkeit als sie Sicherheit von Menschen, die in einem anderen Staat leben. Wenn Robert Habeck nicht-deutsche Gefährder abschieben will, dann muss man sich die grundlegende Logik hinter dieser Forderung anschauen, denn damit ist ganz eindeutig gesagt, dass die Sicherheit des Herkunftslandes eines so genannten Gefährders offenbar riskierbarer ist, als die Sicherheit der Deutschen. Somit ist klar: Menschen, die hierzulande um ihren Schutz bangen, sei es aus nachvollziehbaren, oder weniger nachvollziehbaren Gründen, haben ein anderes Zugriffsrecht auf selbigen, als Menschen anderer Länder.

(Foto: Usien)
Wer diese Auffassung teilt, das sage ich ganz ohne Moral, denkt in nationalistischen Kategorien. Wer glaubt, dass man nationalistischen Überzeugungen Herr wird, indem man migrationspolitisch auf die AfD zugeht, der ist bestenfalls naiv und schlechtestenfalls überzeugt. Denn wir haben es hier tatsächlich nicht mit einer Frage zu tun, bei der es unterschiedliche Auffassung geben kann. Die Frage, die ich meine, lautet: „Kann man die Zustimmung für die AfD verringern, in dem man migrationspolitisch auf die AfD zugeht?" Nochmal, auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben, weil sie wissenschaftlich schon ausreichend häufig gestellt und untersucht wurde. Die Antwort lautet: Nein.
Sämtliche Studien zu dem Thema kommen zum selben Ergebnis: Wenn Parteien im Wahlkampf eine inhaltliche Distanzverringerung zur AfD vornehmen, profitieren davon immer ausschließlich die Rechtsextremen. Und ich möchte eines ganz klar sagen: Ich habe nicht studiert. Ich bin ein achtundzwanzigjähriger Autor, der zu spät aufsteht und zu spät schlafen geht. Wenn ich mir über den Forschungsstand im Klaren bin, wenn ich weiß, dass die Wissenschaft hier ganz klare Erkenntnisse präsentiert, dann weiß ich, dass Lars Klingbeil dazu auch in der Lage ist. An dieser Stelle ist eines ganz wichtig zu verstehen: Die Annahme, dass man Menschen dann nicht verliert, wenn man Teile ihrer Forderungen übernimmt und öffentlich validiert, hat überhaupt erst zu den Überzeugungen geführt, mit denen man es heute zu tun hat.
Als Autor sage ich: Es ist kein Leichtes, die Welt auf bestimmte Weise zu erzählen und damit schlussendlich Überzeugungen zu schaffen. Vor allem ist das etwas, was Zeit braucht. Aber ich empfinde es als meine Pflicht, es zu versuchen. Nicht bloß aus Gründen der Nächstenliebe und Selbstlosigkeit, auf gar keinen Fall. Ich habe hier egoistische Motive. Ich weiß aus Zeiten, in denen ich selbst kühl und zynisch war und das Trennende bewusst gesucht habe, von meiner eigenen Einsamkeit. Ich möchte bewegbar sein und ich möchte in der Lage sein zu erkennen, dass mein Leben etwas mit dem Leben der Anderen zu tun hat. Ich bin bereit, mich der Verlegenheit zu stellen, dass es niemals ein deckungsgleiches Erleben der Welt gibt, aber wenn ich eines von meinem Dreieinhalbjährigen Sohn gelernt habe, dann ist es, dass „So tun als ob“ nicht nur ein wunderschönes Spiel für Kinder ist.
Mir ist völlig klar, dass wir die Macht des Faschismus nicht dadurch brechen, dass wir Gegenerzählungen entwerfen. Ich möchte mich in diesem Beitrag bloß auf das beschränken, was ich kann. Ich bin kein ausgebildeter Theoretiker, aber ich kenne mich mit Sprache aus. Und ich kann Auskunft darüber geben, wie in den letzten Jahren wieder verstärkt ein Wir dahergeredet wurde, welches ein Die Anderen braucht. Ich bin nicht einverstanden mit einem Wir, welches Die Anderen braucht um Wir zu sein. Und meine Gegenwehr gilt allen, die sich für ein solches Wir stark machen. Und deswegen, auch da entscheide ich mich für die Ehrlichkeit, muss ich ganz deutlich sagen, dass ich gerade von denjenigen Akteurinnen und Akteuren enttäuscht bin, die innerhalb vermeintlich progressiver Parteien die Entwicklungen mitgegangen sind, die sich in den letzten zwei Jahren zugespitzt haben. Ich sage es deswegen in aller Deutlichkeit: Es ist mir scheißegal, wie oft Leute von SPD und Grünen noch auf politische Sachzwänge hinweisen oder, angesprochen auf die Migrationspolitik der großen Koalition, die eigene Zustimmung zu den Beschlüssen mit der Notwendigkeit zum Kompromiss begründen: Wer hier mitmacht, kann sich nicht rausreden. Dieses Wir, was von jenen mit befeuert wird, die ich hier kritisiere, ist nicht mein Wir.
Und das sage ich nicht nur aufgrund meiner politischen Gesinnung, sondern durchaus auch nüchtern betrachtend, denn wer soll das sein, Wir Deutschen? Es gibt, wenn man sich bemüht, genauer hinzuschauen, schlicht und ergreifend nicht das eine Deutschland. Hamburg-Blankenese hat ein Pro-Kopf Einkommen auf dem Niveau eines Steuerparadieses, während die Menschen in Duisburg-Marxloh weitaus mehr mit denjenigen gemein haben, die in den ärmsten Ländern Europas leben. Und über diese Tatsache kann auch schwarz-rot-gold gefärbter Wurstaufschnitt zu WM-Zeiten nicht hinweg deuten. Das Nationale Wir ist und bleibt eine Finte derjenigen, die um jeden Preis verhindern wollen, dass Menschen erkennen, was sie tatsächlich mit anderen gemeinsam haben. Denn das, was die allermeisten Menschen in Deutschland gemeinsam haben, ist die Angst davor, finanziell nicht über die Runden zu kommen. Viele können es im größten Niedriglohnsektor Europas schon jetzt nicht, und noch mehr Menschen haben konkrete und berechtigte Angst, dass sie es irgendwann ebenso nicht mehr können. Von den Verhältnissen, die im globalen Süden herrschen, mal ganz zu schweigen, wo durch die Verteilung von globalem Vermögen überhaupt erst die Fluchtursachen geschaffen werden, die nun immer häufiger nicht mehr ausreichen, um in Deutschland Anspruch auf Schutz und Hilfe zu bekommen.
Wenn es also darum geht, darüber nachzudenken, wie man Demokratie konkret praktiziert und damit schützt, dann muss ich doch von allen Beteiligten erwarten können, die Frage zu beantworten, welche Demokratie hier eigentlich gemeint ist. Ist die Demokratie gemeint, die, für Deutschland gesprochen, unabhängig von der konkreten Koalitionszusammensetzung im Bundestag nicht vermag, die Menschen aus der Armut zu holen - schlimmer noch, die an jeder erdenklichen Stellen darauf hinweist, dass jene Armut eine ist, aus der sich nur der Einzelne selbst befreien kann? Eine Armut, die vor allem deswegen aktiv vertieft wird, um als Drohkulisse zu dienen? Ist es die Demokratie, in der 800.000 Privatiers in Deutschland von Geburt an so reich sind, dass sie gar nicht arbeiten müssen? Ist es die Demokratie, in der Klimaschutzmaßnahmen in einem Konkurrenzverhältnis zur Zumutbarkeit eben jener stehen? Ist es die Demokratie, aus der heraus ein deutscher Außenminister von der CDU öffentlich die Überzeugung vertritt, dass das Zurückhalten von Lebensmitteln und ärztlicher Versorgung nachvollziehbare Handlungen der israelischen Regierung im vermeintlichen Kampf gegen die Hamas sind?

(Foto: Mikhail Evstafiev)
Wenn es diese Demokratie ist, um die man sich hier vor Ort so ausgesprochen und wortreich sorgt, dann kann ich nur sagen: Ohne mich. Wenn das Demokratie ist, wüsste ich nicht, was ich zur Verteidigung derselben beizutragen hätte. Wer Demokratie verteidigen will, muss in durchaus radikaler Weise dafür einstehen, sie zu hinterfragen. Und zwar in dem Sinne, als dass die Frage zu diskutieren ist, wie demokratisch eine Gesellschaft sein kann, in der die einen reich und die anderen arm sind, die einen sechsstellige Summen an Parteien zahlen, um ihre Interessen vertreten zu bekommen, während die anderen am Wahltag die Entscheidung treffen müssen, ob eine warme Wohnung oder warmes Essen wichtiger ist für den Rest des Monats. Ein System, in dem die Überzeugung herrscht, dass die Menschen allein für ihr Schicksal verantwortlich sind und jeder schon das bekommt, was er verdient, ist für mich inakzeptabel. Und wer diese Umstände und Grundüberzeugungen nicht hinterfragen will, die auf natürliche Weise immer dazu führen, dass begründbar ist, dass die einen leiden und die anderen leben, der kann sich doch nicht ernsthaft darüber wundern, wenn die Leute keinen Begriff davon haben was a) Demokratie ist und wie man diese b) praktizieren soll.
Ich bin mir selbst ehrlich gesagt nicht sicher, was genau das alles bedeuten soll. Menschen erleben ein so existenzielles Leid, jeden Tag, was sollen sie machen? Was zur Hölle soll eine alleinerziehende Mutter aus der Platte denn beim Bürgerdialog? Woher soll die Hoffnung kommen, dass das Leid, was sie erlebt, eines ist, was verstanden wird? Zu dem sich Menschen ins Verhältnis setzen, entweder, weil sie es selbst kennen, oder weil sie es für inakzeptabel halten. Der überwiegende Teil derjenigen, die in Deutschland nicht an Wahlen teilnehmen, sind arm. Es ist eine ungeheuerliche Frechheit, zu behaupten, diese Menschen seien politikverdrossen. Das Gegenteil ist der Fall: Diese Politik ist menschenverdrossen. Was sage ich also Leuten, und ich habe diese Gespräche geführt, die mir sagen: Warum soll ich zur Wahl gehen, es ändert sich nichts? Was sage ich denen? Ganz ehrlich, ich habe ihnen gesagt, dass ich es verstehe. Ich kann aber von Herzen sagen, dass ich Hoffnung habe. Meine Hoffnung lautet wie folgt: Ich glaube, dass es genug Menschen gibt, welche die Fähigkeit besitzen, das Politische fühlbar zu machen.

(Foto: Alexander Hauk)
Nochmal: Ich habe nicht studiert. Ich bin ein achtundzwanzigjähriger Autor, der zu spät aufsteht und zu spät schlafen geht. Wenn ich mir meinen Zynismus abgewöhnen konnte, dann können das alle. Denn ganz ehrlich: Ich war bis vor knapp einem Jahr ein linker Kotzbrocken, der dadurch bekannt wurde, alles und jeden kacke zu finden, der nicht so links war, wie ich es für richtig hielt. Nicht bloß aus ehrlichem Interesse an den Inhalten, oder aus der Überzeugung heraus, dass Kritik wichtig ist, sondern auch und vor allem für das eigene Ego: Abgrenzung um jeden Preis, ich bin richtig links, die anderen sind nur halb-links. Und dann geschah etwas, was das Politische für mich fühlbar gemacht hat. Mein Vater starb, im April vergangenen Jahres. Der Tod wird von vielen etwas angesehen, was persönlich ist, persönlich in dem Sinne, dass jeder Mensch auf seine eigene lebt und auf seine eigene Weise stirbt. Mein Vater ist auf ähnliche Weise gestorben, wie viele Menschen sterben, jeden Tag. Er ist in einem Gesundheitssystem gestorben, in dem manche Behandlungen finanziell lukrativer sind, als andere. Krankenhäuser und Kliniken sind dazu gezwungen, profitorientiert zu arbeiten.
Die Behandlung der Krankheit meines Vaters war nicht besonders profitabel. Er starb weitaus früher, als es hätte sein müssen. In den Monaten nach seinem Tod kam ich in Kontakt mit unzähligen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Ich habe verstanden, dass der Tod meines Vaters in der Art und Weise, wie er vonstatten ging, nichts Besonderes war. Und anders, als man vielleicht annehmen würde, ist das etwas Heilsames für mich. Es täuscht nicht über den Verlust hinweg, im Gegenteil: Es zeigt mir an, dass ich und viele andere etwas zu verlieren haben, nämlich eine Welt, in der nicht der Kontostand darüber entscheidet, wie lange Menschen leben. Nichts an meiner Geschichte ist besonders, nichts an meiner Trauer ist besonders. Nichts ist besonders an der Tatsache, dass ich manchmal nicht weiß, ob ich richtig trauere. Es ist geteiltes Erleben vieler Menschen und ich bin zum ersten Mal bereit, das Besondere, Trennende, Unterscheidende aufzugeben. Der Tod meines Vaters hat keinen weiteren Sinn, nur den, dass er mich erkennen ließ, dass es sich vielleicht lohnt zu wagen, weniger Ich zu sein, wenn man dann ein wenig mehr Du sein kann.
Mein politischer Kampf ist deswegen seitdem, und ihr könnt mich deswegen gern als Hippie bezeichnen, in Verbindung zu sein. Ich möchte dafür kämpfen, zu erkennen, was ich mit Anderen gemein habe. Und das schließt ein, sich gegen Ideen zu stellen, die uns einreden, es bräuchte ein Die Anderen für ein Wir.
*Scheiß auf Selflove, gib mir Klassenkampf - Eine neue Kapitalismuskritik, Verlag Rowohlt, 160 Seiten, 12 Euro
Jean‑Philippe Kindler
… 1996 in Duisburg geboren und in Düsseldorf aufgewachsen, ist Satiriker, Slam-Poet, Moderator, Autor und Podcaster. 2017 gewann er den NRW-Poetry-Slam sowie 2018 die deutschsprachige Meisterschaft. Sein Solo-Kabarettprogramm Mensch ärgere dich wurde mit der St. Ingberter Pfanne, dem Rostocker Koggenzieher sowie dem Prix Pantheon ausgezeichnet. Kindler ist Co-Host der Podcasts Utopia, Nymphe & Söhne und Studio Kindler sowie Moderator bei WDR 5 – u. a. mit Kindler - der Talk. 2023 veröffentlichte er sein politisches Sachbuch Scheiß auf Selflove, gib mir Klassenkampf, in dem er Kapitalismuskritik und soziale Gerechtigkeit verbindet - ein SPIEGEL-Bestseller.
Der Text (hier: leicht gekürzt) entstand im Rahmen der Veranstaltung „Fest der Demokratie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung am 24.5.2025 in Köln, wo Jean-Philipp Kindler mit dem Zukunftspreis der Demokratie ausgezeichnet wurde. Die in diesem Text zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind nicht notwendigerweise die der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES). Weitere Informationen: www.fes.de