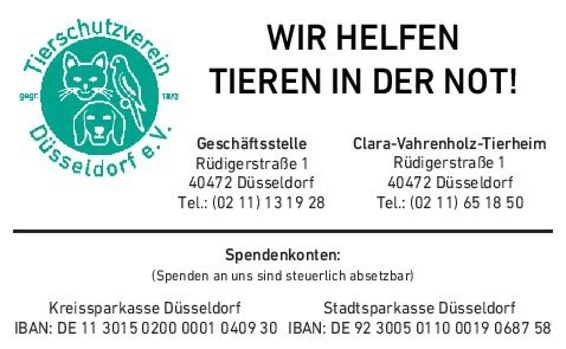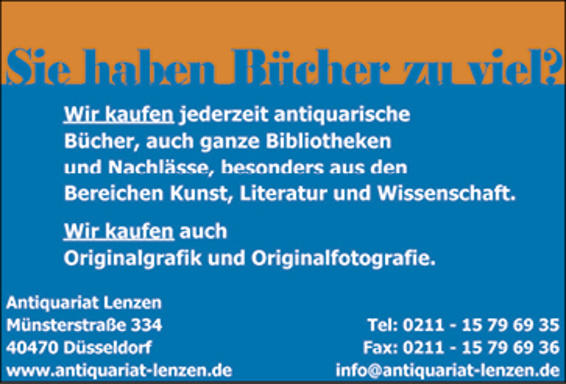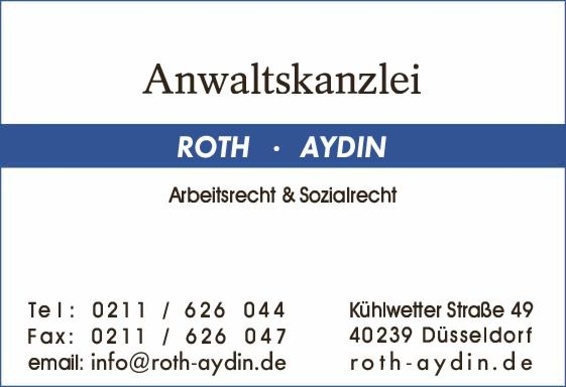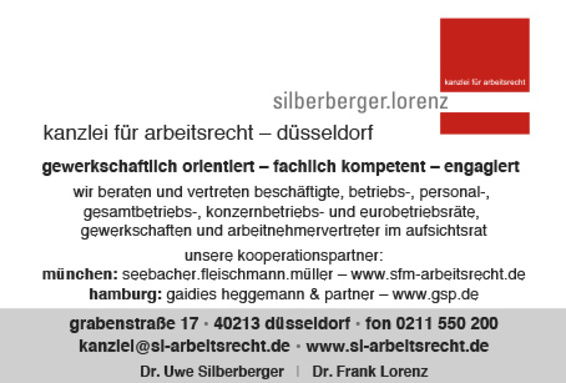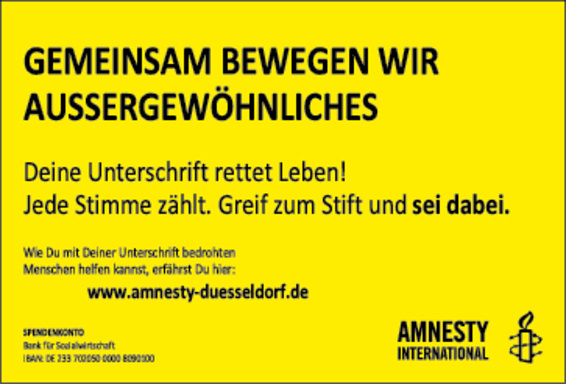Blumenkinder veränderten die Welt
Angesichts der aktuellen Zustände, in der alle positiven Veränderungen abgeblockt scheinen und politische Kreativität sich in Rüstung und Kriegertum erschöpft, lohnt es, einen Blick zurückzuwerfen: Wie kam es vor 60 Jahren zu jener pazifistischen, fantasievollen Bewegung, die aus den USA nach Europa schwappte und die Gesellschaft grundlegend veränderte?
Die Rede ist von den „Blumenkindern“, die mit Flower Power so viel erreichten und hierzulande die „Achtundsechziger“ inspirierten. Es begann mit zwei Protestbewegungen: Zunächst war da schon lange der Kampf gegen den Rassismus. Beflügelt von den Erfolgen gegen den Kolonialismus – 1959 gewann die Revolution auf Kuba, 1960 befreite sich die erste Kolonie in Afrika – erlebte dieser Kampf einen Höhepunkt im August 1963 mit dem Marsch auf Washington. 250.000 Menschen forderten dort das Ende der Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung, Martin Luther King hielt seine berühmte Rede: I have a Dream und Joan Baez sang ihr unsterblich gewordenes Lied: We shall overcome. Es ist ein spiritueller Gospelsong voller Siegesgewissheit: „Wir werden (diese Zustände) überwinden!“ Ein knappes Jahr später verbot der Civil Rights Act die Diskriminierung nicht nur der Afroamerikaner, sondern jegliche Benachteiligung aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft. Endlich gab es eine juristische Handhabe, um dagegen vorzugehen.
Der andere Protest, der sich wie ein Flächenbrand ausbreitete, entzündete sich am Vietnamkrieg. Seit der Teilung 1955 wurde Südvietnam von den Vereinigten Staaten militärisch unterstützt gegen den kommunistischen Norden, hinter dem die Sowjetunion und China standen. Im August 1964 traten die USA mit der Entsendung von Truppen offiziell in den Krieg ein. Die Proteste wuchsen an, aber sie veränderten auch ihren Charakter. Alan Ginsberg, einer der wichtigsten Autoren der sogenannten Beat-Poeten, forderte im November 1965, dass den Antikriegs-Demonstranten „Massen von Blumen“ zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie an Polizisten zu verteilen. Damit prägte er den Begriff Flower Power.
Die Macht der Blumen war das Kennzeichen der gewaltlosen Protestbewegung. Dass es tatsächlich so friedlich zuging, liegt nach der Deutung mancher Historiker auch an den Drogen, die bei den Demonstrationen, Konzerten und Sit-ins konsumiert wurden. Marihuana macht friedlich, wie sonst hätte im legendären Woodstock-Festival 1969 eine halbe Million Menschen drei Tage ohne Konflikte auf einer verschlammten Wiese zubringen können?
Wie dem auch sei, die Bewegung erfasste alle Bereiche. Die Blumenkinder akzeptierten die Regeln der konservativen, antikommunistischen, patriarchalischen US-Gesellschaft der 50er Jahre nicht mehr. Freie Liebe wurde propagiert – die Erfindung der Anti-Baby-Pille machte sie möglich. 1967 versammelten sich die Hippies in San Francisco und lebten im legendären Summer of Love ihre Gegenkultur aus, zu der neben Drogenrausch, langen Haaren und Schlabberlook auch die Suche nach einer neuen Spiritualität gehörte, die sich teilweise an der Religion der native Americans orientierte. Und immer viel Musik!
Die Hymne dieses Sommers war San Francisco von Scott MacKenzie. Sie beginnt mit der Aufforderung, sich Blumen ins Haar zu stecken: „If If you′re going to San Francisco/
Be sure to wear some flowers in your hair …“ Darin findet sich auch die Strophe: Überall im Land/So eine starke Schwingung/Menschen in Bewegung … /Eine ganze Generation/mit einem neuen Selbstverständnis ...
Times they are changing, hatte Bob Dylan schon 1964 angekündigt:
Kommt Mütter und Väter im ganzen Land
und kritisiert nicht, was ihr nicht verstehen könnt.
Eure Söhne und Töchter sind jenseits eurer Kontrolle.
Eure alte Straße altert rapide.
Bitte geht runter von der neuen,
wenn ihr nicht zur Hand gehen könnt,
denn die Zeiten ändern sich.
So geschah es spätestens 1968 auch in Europa. Die StudentInnen in Paris gingen im Mai auf die Straßen, Jean Paul Sartre bewunderte ihre buchstäblich „umwerfende“ Phantasie. In Deutschland spotteten sie gegen die alte Professorenschaft: „Unter den Talaren/ der Muff von tausend Jahren“. Die Jugend lehnte sich gegen die Elterngeneration auf und befragte die Väter, was sie denn im Krieg getan hätten. Die Frauen begannen, ihre Rolle in Frage zu stellen, es entstand die neue Frauenbewegung. Kunst und Kultur vollzogen die Erneuerung mit.
Es ist ungefähr 60 Jahre her, dass in den USA und in Europa die junge Generation in Bewegung geriet und die Gesellschaft schuf, in der wir heute (noch) leben. Wo entsteht aber heute etwas Neues? Hier oder irgendwo in der Welt?
Eva Pfister