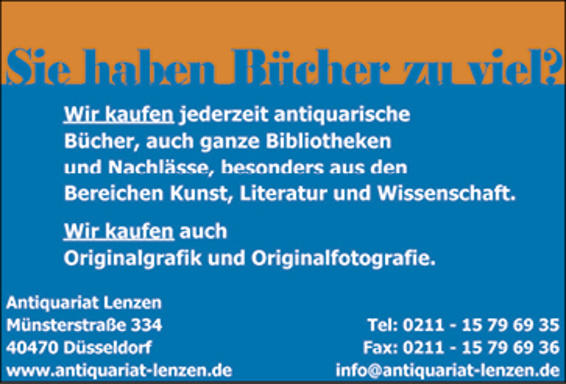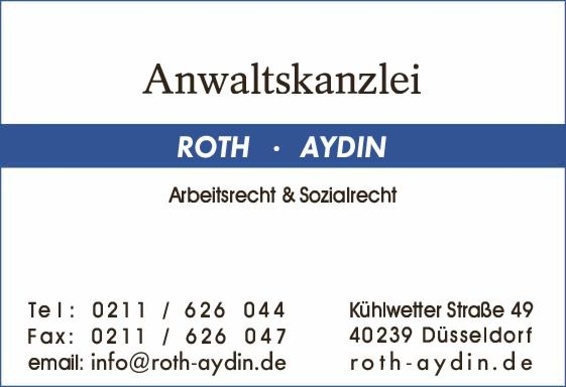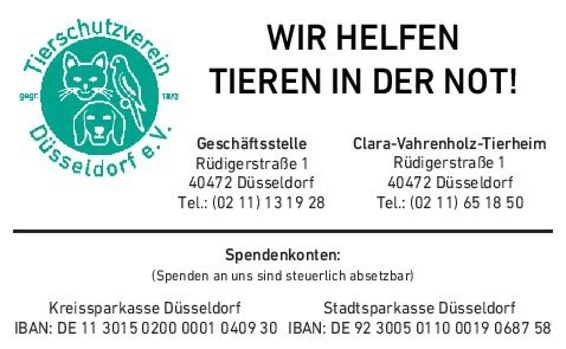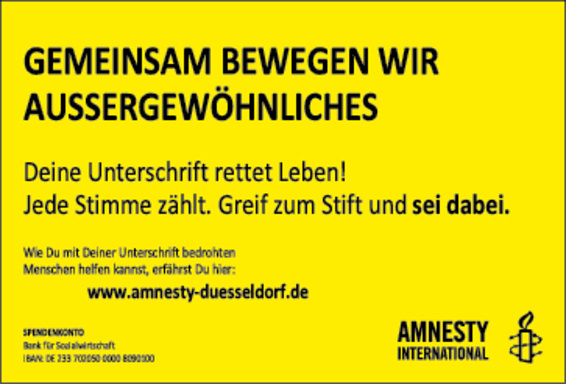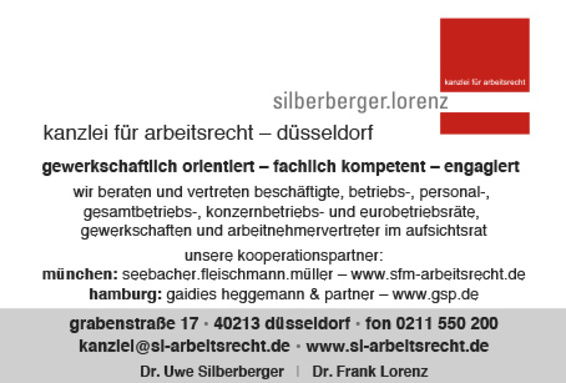Rote Insel, Blaue Zone
Es kommt nicht oft vor, dass man heutzutage auf selbsternannte Kommunisten trifft, doch auf der griechischen Insel Ikaría gibt es viele. Hier teilen sie gleichberechtigt und beweisen, dass ein solidarisches Wirtschaften möglich ist. Reichtum winkt hier nicht – dafür die Chance auf ein stressarmes, gesundes und langes Leben.
Von Malin Clausson. Fotos von Lisa Thanner
Bei einer Reise nach Ikaria werden die Nerven auf eine harte Probe gestellt: erst in der kleinen Propellermaschine, die auf der kurzen Landebahn mit den schweren Bremsspuren landet, dann wieder in großer Höhe, diesmal in einem kleinen Mietwagen. Wir kriechen mit dem vorgeschriebenen Tempolimit von 20 km/h. Stellenweise sind die Kurven praktisch Kehrtwenden und die Straßen ohne Leitplanken. Wir halten den Atem an und schnappen nach Luft beim Anblick der Ägäis, wo Samos am Horizont zu sehen ist. Oben ist es windig und karg. Doch etwas weiter unten erstrecken sich Wälder und üppige Olivenhaine, die die Inselbewohner jahrhundertelang vor Piraten und in jüngerer Zeit vor deutschen und italienischen Invasoren im Zweiten Weltkrieg geschützt haben.
Niemand kann auf Kosten anderer expandieren
Olivenbauer Lefteris Trikiriotis nennt den Kommunismus auf Ikaría „soziale Weisheit“. Ein wirtschaftliches Verteilungsmodell, das seit jeher darauf ausgerichtet war, sicherzustellen, dass die Ressourcen der Insel ausreichen und niemand auf Kosten anderer expandieren kann. Die etwa 20 Haushalte der Gegend sind in verschiedenen Höhenlagen und um ein zentrales Gewässer verstreut angesiedelt. Trikiriotis zeigt uns den Teich, in dem sich das Quellwasser vom Berggipfel sammelt, und erläutert, wie das Wasser je nach Bewohnerzahl verteilt wird. Familien können so wachsen – andere Formen der Expansion werden jedoch gebremst. „Nehmen wir an, Sie möchten Ihren Olivenanbau verdoppeln, um mehr Geld zu verdienen. Niemand kann Sie davon abhalten, aber Sie bekommen dafür nicht mehr Wasser für Ihre Bäume. Die Ration ist, wie sie ist“, erklärt er. Seine Vorfahren leben und arbeiten seit dem 14. Jahrhundert sowohl auf Samos als auch auf Ikaría. Vor zwanzig Jahren übernahm er 10 Hektar schwer zu bearbeitenden Terrassenanbau auf 700 m Höhe, der nun auf mehrere Familien aufgeteilt ist. Die Olivenernte 2024 war reichlich und wurde gleichmäßig unter den Familien aufgeteilt. Trikiriotis ist einer von vielen auf Ikaría, deren Leben eine Kehrtwende nahm. Mit 24 Jahren beschloss er, Athen und damit seine Karriere, sein Geld und seinen Stress für ein finanziell deutlich ärmeres, aber in anderer Hinsicht reicheres Leben zu verlassen. „Ich war Chef eines großen Unternehmens, das andere Branchen weltweit belieferte, darunter Coca-Cola in den USA, und arbeitete sechs Tage die Woche rund um die Uhr. Das Handy war ständig eingeschaltet, immer in Bereitschaft. So will ich nicht leben.“ Das Interesse, sein eigenes Land zu bewirtschaften und von seiner eigenen Arbeit zu leben, trieb ihn auf die Insel, wo er die Sommer seiner Kindheit bei seinen Großeltern verbracht hatte. Doch die Entscheidung, einen Universitätsabschluss und einen guten Job für eine neue und prekäre Existenz aufzugeben, stieß nicht sofort auf Begeisterung. „Meine Eltern und Freunde sahen voraus, dass ich scheitern würde, weil ich nicht hier aufgewachsen bin. Aber ich musste es versuchen, sonst hätte ich es mein Leben lang hinterfragt“, sagt er.
Landbau nur mit dem, was die Natur hergibt
Sein Cousin traf später dieselbe Entscheidung, ebenso wie ein Freund, der als Imker arbeitet. Heute teilt Trikiriotis sein einfaches Steinhaus aus dem 18. Jahrhundert mit seiner Frau Irini und der achtjährigen Tochter. Sie essen hauptsächlich selbst angebaute Lebensmittel: Obst und Gemüse, verschiedene Kartoffelsorten, Weintrauben, Heilpflanzen, Lavendel, essbare Blumen und Kräuter. „Wir lieben die Vielfalt“, sagt Trikiriotis und erklärt seine Methode für die kleinbäuerliche Landwirtschaft. „Man wird sehr verwundbar, wenn man nur eine Sache anbaut.“ Beim naturnahen Lebensstil auf Ikaría geht es aber nicht nur darum, was, sondern vor allem wie man anbaut – ohne Zusätze von irgendetwas anderem als dem, was die Natur selbst hergibt. Beim Ölpressen gelangen die Olivenschalen zurück in den Boden; dasselbe gilt für die Traubenreste, wenn Wein nach alter Methode in Erdkellern gelagert wird. Die Rolle des Menschen als Teil der Natur bestehe darin, den Boden zu schützen und Verunreinigungen durch Kunstdünger zu vermeiden, erklärt er. Die Oliven werden von Hand gepflückt, andere mithilfe eines einfachen Werkzeugs, einer Art Spinnrad, das die Oliven, ohne die Bäume zu beschädigen, auf den mit Netzen bedeckten Boden „fegt“, sodass alles gesammelt und verwendet werden kann. In Säcken wird die Olivenernte der Familien zu einer Werkstatt in eines der Dörfer transportiert, wo die Oliven gewogen, von Blättern befreit, gepresst und in Ölkannen abgefüllt werden. Die Familie produziert zwei Sorten Olivenöl: extra vergine und nativ. Irini stellt auch Seife und andere Hautpflegeprodukte her. Was übrig bleibt, nachdem die Familie ihren Bedarf gedeckt hat, dient als zusätzliches Einkommen. Im Herbst 2024 waren die Oliven ungewöhnlich früh reif. Als wir Trikiriotis besuchen, sind es nur noch wenige Arbeitstage bis zur Olivenernte, die sonst normalerweise bis Mitte Dezember dauert. „Die Dürre hat die Bäume gestresst. Wir mussten sie abpflücken“, sagt Trikiriotis und erklärt, wie reife, nicht geerntete Oliven den Bäumen Nährstoffe entziehen. Im schlimmsten Fall können die Bäume verfaulen, wenn sie nicht rechtzeitig abgeerntet werden. Aber es war ein gutes Jahr mit vielen Oliven, sagt er. Etwa einmal im Monat führt Trikiriotis geführte Wanderungen auf der Insel durch. Das trägt zum Lebensunterhalt der Familie bei, verbreitet aber auch altes Wissen, das nun verloren zu gehen droht.

Giannis Melissokomos pflegt seine 150 Bienenstöcke mit derselben Achtsamkeit,
als wären sie die Heimat von Menschen.
Chrysa Koiliari, die im Dorf Raches eine Unterkunft gemietet hat, stimmt zu: „In zwei Generationen wird wahrscheinlich alles zerstört sein, was hier seit Jahrtausenden in einem natürlichen Kreislauf kultiviert wurde. Es genügt, einen gekauften Tomatensetzling in die Erde zu stecken, und die DNA der Insel wird sich verändern. Ahnungslose Neuankömmlinge werden alles zerstören.“ Sie selbst ist in Athen aufgewachsen und kann sich nicht erinnern, in der Schule jemals etwas über Terrassenlandwirtschaft gelernt zu haben. Sie hat sich bewusst entschieden, mit ihrem Sohn auf die Insel zu ziehen. Sie lobt die örtliche Grundschule als sichere und herzliche Umgebung für die Kinder, wo sie auch etwas über die Umwelt lernen. „Der Nachteil ist, wenn Kinder krank werden. Auf Ikaría gibt es keinen Kinderarzt“, sagt Chrysa.
Irgendwo ist hier immer ein Fest: „Wir feiern alles!“
Das tägliche gemeinsame Essen mehrerer Generationen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das nachweislich hohe Wohlbefinden auf Ikaría. Nicht selten findet das gesellschaftliche Leben auch in größeren Zusammenkünften auf dem Platz statt, wo sich die Dorfbewohner aus dem kleinsten Anlass zum Panagiri versammeln, einem traditionellen Festmahl mit Essen, Wein, Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden. Zwischen April und Oktober gibt es jede Woche einen Anlass zum Feiern. Irgendwo auf der Insel treffen sich die Dorfbewohner fast täglich zum geselligen Beisammensein. „Wir feiern alles, ständig!“. Jeder auf der Insel teilt, was er hat. Essen und Getränke werden auf langen Tischen angerichtet, und unabhängig davon, wer etwas zu den Köstlichkeiten beigetragen hat, kann jeder teilnehmen, sich satt essen und Kontakte knüpfen. Heute gibt es keine Party, aber Angelo hat einen Freund aus einem anderen Teil der Insel zu Besuch. Die Erwachsenen trinken kleine Gläser Wein – von dem Angelo sagt, dass auch seine Altersgenossen ihn oft trinken. „Sicher nicht so viel“, sagt Vasilia Samiotis und zieht eine Augenbraue hoch. Schließlich ist sie Lehrerin und glaubt, die 120 Schüler und ihre Familien gut im Blick zu haben. „Mama, du weißt nicht alles“, schnaubt Sohn Angelo, wie es sich für einen 14-jährigen Teenager gehört, und erzählt uns, dass viele junge Leute auch rauchen, obwohl er von anderen Drogen auf der Insel noch nichts gehört hat.

Die gemeinsam angebauten Früchte werden auch gemeinsam verzehrt.
Vasilia zog als alleinerziehende Mutter hierher und fand eine enge Gemeinschaft, in der sich die Menschen gegenseitig unterstützen. Sie wurde gerettet – wenn auch nicht im religiösen Sinne. Es gibt eine Vielzahl kleiner Kirchen auf der Insel, aber bisher haben wir nicht mal sonntags eine gefunden, die geöffnet war, und als ich Vasilia frage, wie religiös die Inselbewohner sind, lacht sie: „Überhaupt nicht! Nein, nein! Niemand geht in die Kirche! Die Insel ist rot!“ Ihre Eltern gesellen sich zu ihr, finden die Frage ebenfalls amüsant, fügen aber lächelnd hinzu: „Wir respektieren religiöse Traditionen, und im Mittelalter war man hier natürlich sehr religiös, griechisch-orthodox, und bis heute feiern wir jeden Heiligen, von dem wir je gehört haben, um im Dorf einen Grund zum Feiern zu haben.“
Die Kirchen werden nur an Feiertagen genutzt, um die Toten und Vermissten zu ehren, erläutert man uns. Diese „Gedenkveranstaltungen“ werden als Feiern beschrieben, bei der die Kirchen in Bankettsäle verwandelt werden. „Dann backen wir Süßigkeiten und trinken morgens Ouzo. Sehr nett“, merkt Vasilia an. Für sie ist das moderne Leben in Athen und im Rest der westlichen Welt ein Bild der Katastrophe; eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht glücklich sind. In letzter Zeit kommen Menschen mit dem Traum von einem alternativen Leben hierher, genau wie sie damals. Aber sie sehen sich mit dem Problem konfrontiert, dass es keine Arbeit gibt. Sie selbst konnte Arbeit als Lehrerin finden und zusammen mit ihren Eltern einen Freizeitbauernhof betreiben. „Jeder, der einen Bauernhof hat und in der Lage ist, Landwirtschaft zu betreiben, kann hier erfolgreich sein. Wer nicht die Möglichkeit hat, den Boden zu bestellen, den erwartet kein leichtes Leben, er befindet sich aber in einer solidarischen Gemeinschaft.“
Kaum irgendwo sonst leben so viele gesunde Menschen über 90 Jahren
2008 wurde Ikaría vom Bestsellerautor und Weltenbummler Dan Buettner als eine der wenigen verbliebenen „Blauen Zonen“ der Welt identifiziert. Gepaart mit guter Gesundheit, ist die Lebenserwartung der Menschen hier bemerkenswert hoch. Auf der Insel leben dreimal so viele gesunde Menschen über 90 Jahre wie in Griechenland insgesamt, und pro 100.000 Einwohner gibt es mehr Hundertjährige als an jedem anderen Ort der Welt. Die Zutaten für ein gesundes, langes Leben, das Demenz und Herzkrankheiten vorbeugt, sind das oben beschriebene soziale Zusammenleben, gesunde Ernährung, Wein (reich an Antioxidantien), Mäßigung (kleine Portionen und kleine Gläser) und Stressfreiheit. Die landwirtschaftliche Arbeit sorgt zudem für tägliche Bewegung, Appetit und erholsamen Schlaf. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist fast vollständig autark und benötigt kaum Importe. Neben Olivenöl und Wein gehört auch Honig zum Alltag, der zur Linderung von Magengeschwüren, Erkältungen, Grippe und sogar leichten Katern verwendet wird.
Giannis Melissokomos, 41, lebt in einem kleinen Steinhaus hoch oben in den Bergen an der Südwestküste Ikarías. Er besitzt 150 Bienenstöcke. Manchmal wohnt auch seine Freundin aus Amsterdam bei ihm. Im November heizt er die kleine Behausung mit einem holzbefeuerten Eisenofen und zieht mehrere Kleidungsschichten gegen die Kälte übereinander. Landleben in seiner einfachsten Form. Als Melissokomos, der in jungen Jahren als Motorradmechaniker in Athen arbeitete, gebeten wird, seinen Lebensstil zu beschreiben, sagt er: „Ich habe nie daran gedacht, Griechenland zu verlassen. Ich habe keine höhere Schulbildung, daher war das für mich keine Option. Ich hatte jedoch den Wunsch, anders zu leben.“ Aufgefordert, die Vor- und Nachteile aufzuzählen, fallen ihm der Fleiß der Bevölkerung, die Liebe zu seiner Insel und ihren Traditionen, die soziale Struktur und die fröhlichen Feste ein. Ikaria sei, wie jeder Besucher weiß, ein wunderschöner Ort zum Leben. Mangelhaft sei die Infrastruktur – das Straßennetz, die Gesundheitsversorgung und die Schulen. Die Insel hat Mühe, ausgebildete Lehrer zum Umzug zu bewegen. Wenn es seiner Imkerei gut geht, würde er gerne auf der Insel bleiben. Im Gegensatz zu dem Egoismus, der sich weltweit verbreitet habe, sieht er hier, wie sich die Menschen gegenseitig helfen. Es herrscht Solidarität. Er vergleicht es mit einem Bienenstock: „Wie Bienen denken auch die Bewohner Ikarías nicht in erster Linie an sich selbst. Sie denken an ihre Gemeinschaft.“
„Kriminalität? Nein“, sagt der Polizist lächelnd
Wie Trikiriotis bietet auch Melissokomos Führungen für alle an, die mehr über seine biologische Imkerei erfahren möchten. Sein Kiefernhonig ist reines Naturprodukt ohne Zusatzstoffe. Er wird von Bienen hergestellt, die nie „Überstunden machen“ und sich von ihrem eigenen Produkt ernähren. „Es ist wichtig, ihnen nicht alles wegzunehmen, die Produktion niemals zu maximieren oder zu überfordern. Der Gewinn liege in gesunden und langlebigen Bienenpopulationen“, erklärt er. „Es ist nicht profitabel, aber ich habe mich entschieden, mich einer Imkergemeinschaft anzuschließen, die meine Ideale teilt.“ Außerdem müsse er seine Tür nie abschließen und könne seine Habseligkeiten, Bienenstöcke und Werkzeuge draußen im Hof lassen, sagt er als Beispiel dafür, wie es sei, hier zu leben. Auf Ikaría stiehlt niemand etwas. Ist das wirklich wahr? Wir fragen den einzigen Polizisten der Insel, den wir in einer kleinen Station am Rande des Dorfes Evdilos antreffen. „Kriminalität? Nein“, sagt der Polizist und gibt lächelnd zu, dass er in zwei Monaten keinen einzigen Fall gehabt habe. Wirklichen Bedarf für Polizeieinsätze gebe es nur im August, wenn Griechen vom Festland Urlaub machen. Dann könne es zu Fällen von „häuslichem Ärger“ kommen, weil Beziehungen während der Ferienzeit tendenziell schwieriger seien. Er sei nur für sechs Wochen auf der Insel stationiert, sagt er.

Der Familienzusammenhalt ist sehr eng. Hier zu Hause bei Vasilia Samiotis mit ihren Eltern, ihrem Sohn Angelo und dessen Freund.
Ikaría wird heute von vielen als letzter Außenposten derer angesehen, die vor allem ein langes, gesundes Leben anstreben. Doch für manche Einwohner Ikarías ist dieser Ruf eine Plage. Konflikte entstehen vermehrt auch in Facebook-Gruppen, wo sich Angebote von privat vermieteten Ferienunterkünften häufen, gefolgt von wütenden Posts, die Ausbeutung und Marktdenken befürchten. Vasilia Samiotis ist optimistisch und stolz auf das positive Image der Insel. Als Lehrerin sieht sie auch die Notwendigkeit einer gewissen Binnenmigration, um das Wachstum zu sichern. Angelo hingegen ist besorgt. „Ich denke, es war ein Fehler, öffentlich zu machen, dass wir eine Blaue Zone sind, denn jetzt kommen immer mehr Menschen hierher, und Stromversorgung und Müllabfuhr werden immer schwieriger. Bald könnten die Ressourcen nicht mehr ausreichen“, sagt er. „Vielleicht kann ich in Zukunft daran arbeiten, unsere Insel sauber zu halten.“ Ihre roten Ideale sind vielleicht die natürliche Bremse, die Ikaría braucht, um Ausbeutung zu vermeiden. Die Insel ist für diejenigen, die Wert auf Wohlstand legen, nicht attraktiv: Es gibt kaum etwas zu kaufen und man ist auf seine Nachbarn angewiesen, wenn man in Schwierigkeiten gerät. Ikaría unterliegt zwar den gleichen Regeln wie der Rest Griechenlands, daher gibt es natürlich Unterstützung von der Gemeinde und dem Staat, wenn man krank wird oder anderweitig seine Lebensgrundlage verliert. „Aber die Solidarität unter den Bewohnern ist eine viel wirksamere Unterstützung“, sagt Samiotis.

Bei der Weinproduktion arbeiten die Familien eng zusammen.
Wir werden zu einem weiteren Weingut in den Bergen geführt, das eines neuen, kleinen Produzenten. Dimitris Tryferos und seine Frau Maria lotsen uns per WhatsApp zu dem Keller, der mitten im Nirgendwo liegt. Das letzte Stück des Weges führt uns einen steilen Pfad hinunter, den wir langsam und stetig beschreiten, wie die 41.000 Ziegen der Insel. Dann erscheint das Dach eines kleinen Schuppens. Es ist nicht der Wohnsitz der Tryferos, sondern ihr Arbeitsplatz, und die kleinen Reben, die im kargen Boden vor dem in den Fels gesprengten Keller gepflanzt sind, sehen nicht gerade vielversprechend aus. Das Weingut wirkt fremdartig in seiner Einfachheit, doch die Familie ist begeistert von ihrer Arbeit. „Ich liebe Wein!“, sagt Dimitris und lädt uns zum Probieren ein. Sein Stolz auf den Herstellungsprozess, einschließlich der Lagerung in Holzfässern im Keller und in großen, in Erdlöcher gegrabenen Tongefäßen, ist deutlich spürbar. Keine Zusatzstoffe. Der Alkoholgehalt hingegen ist recht hoch. Die Familie lebt außerhalb von Evdilos, unten an der Küste, wo sie ihren Wein in einem der kleinen Läden der Insel an Einheimische und Touristen verkauft. Sie hoffen, expandieren zu können. Maria stammt aus Athen und vermisst seit ihrem Umzug nach Ikaría vor 15 Jahren nur eines an der Großstadt: „Das kulturelle Leben!“ Ich gehe gerne ins Theater und zu Konzerten und möchte, dass mein Sohn auf die Musikschule geht. Aber ich möchte nicht zurückgehen. Hier gibt es keine Einsamkeit, keine Obdachlosigkeit, keine Kriminalität, und die Kinder können sich frei bewegen. Dafür lohnt sich alles.“
Mit freundlicher Genehmigung von Faktum (Göteborg) / INSP.ngo. Aus dem Englischen übersetzt (gekürzt) von Hans Peter Heinrich