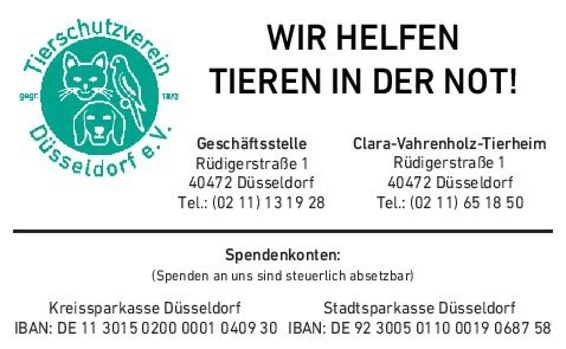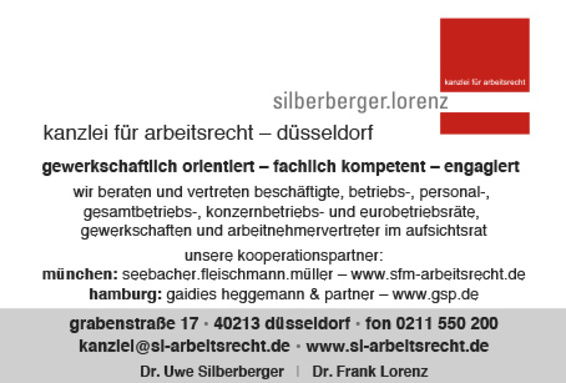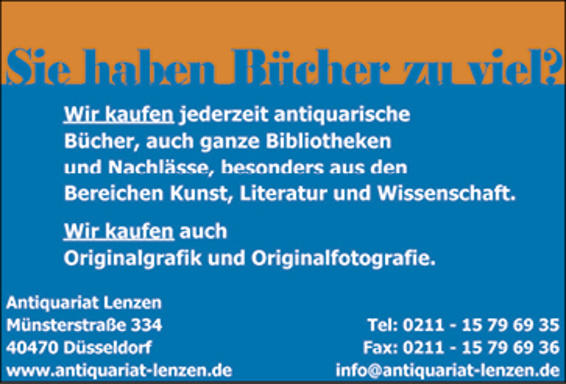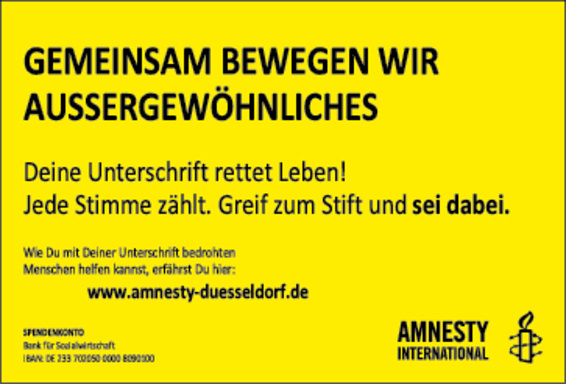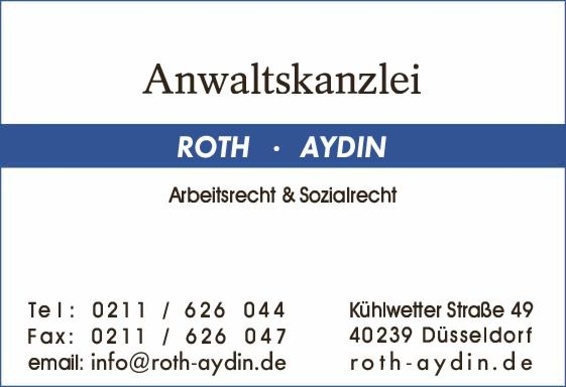Wie wäre es mit einer breiteren politischen Kultur bei uns?
Aus der Rede des Alterspräsidenten Gregor Gysi zur Eröffnung der ersten Sitzung des 21. Deutschen Bundestags
Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste,
als ich 1990 das erste Mal für den Bundestag kandidierte, trugen junge Mitglieder meiner Partei ein Plakat, auf dem stand, dass ich noch Alterspräsident werde. Das hielt ich für einen netten Scherz, habe aber niemals daran geglaubt. Sie sollten Recht behalten, nicht ich. Nun bin ich zwar nicht der älteste Abgeordnete, aber der Dienstälteste. Die Bürgerinnen und Bürger der alten Bundesrepublik Deutschland konnten schon seit August 1949 zu den Wahlen antreten, ich erst seit Ende 1990. Alle aus den alten Ländern zu überholen, war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. (…)
Der neu gewählte Bundestag, der sich heute konstituiert, muss in einer schweren Zeit agieren. Es gibt immer mehr bewaffnete Konflikte auf unserem Planeten. Wir haben einen Krieg in Europa, kriegerische Auseinandersetzungen im Nahen Osten und viele bewaffnete Konflikte in Afrika. Das Völkerrecht wird von vielen Seiten immer wieder verletzt.
Wir sind uns hoffentlich alle einig, dass Russland gegen die Ukraine einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Das müssen wir verurteilen. Wir brauchen eine neue Sicherheitsstruktur, eine neue Friedensordnung für Europa. Das geht nicht ohne Russland, ist aber eine schwere Aufgabe.
Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages geht davon aus, dass man durch die Bundeswehr und deren Waffen ein hohes Abschreckungspotential benötigt, so dass kein Land sich wagte, uns anzugreifen. Sie meinen, dass nur auf dieser Basis auf Augenhöhe Verhandlungen geführt werden können. Diejenigen, die das anders sehen, zum Beispiel ich, dürfen diejenigen, die diesen Standpunkt vertreten, nicht als Kriegstreiber bezeichnen. Denn sie wollen ja auf ihrem Weg Frieden sichern.
Die Minderheit im Haus, zu der ich gehöre, vertritt eine andere Auffassung. Die Regierungen von Finnland und Schweden begründeten ihren Beitritt zur NATO damit, dass Russland sie dann nicht mehr angreifen könne, weil ein Angriff auf sie den Bündnisfall auslöste, es zum dritten Weltkrieg käme, so dass auch von Russland so gut wie nichts übrigbliebe. Da Deutschland schon Mitglied der NATO ist, muss das auch für Deutschland gelten. Nun wird zurecht bezweifelt, dass die USA noch zu ihrer Verpflichtung stehen.
Trotzdem, wenn alle anderen Mitglieder zu ihrer Verpflichtung stünden, kann sich Russland auf einen solchen Krieg nicht einlassen. Diese Minderheit im Bundestag setzt deshalb auf Deeskalation, Interessenausgleich, viel mehr Diplomatie, gegenseitige Abrüstung und die strikte Wahrung des Völkerrechts durch alle Seiten. Das ist ihr Weg zum Frieden. Die anderen sollten solche Menschen nicht Putin-Knechte nennen. Denn es geht ihnen auch um nichts anderes als um Frieden.
Die Bundeswehr muss selbstverständlich verteidigungsfähig sein. Niemand bestreitet, dass die französischen Streitkräfte in der Lage sind, Frankreich zu verteidigen. Im Jahre 2023 gab der französische Staat laut Statistischem Bundesamt für seine Armee und Rüstung insgesamt 61,3 Milliarden US-Dollar aus. Wir gaben im selben Jahr für Armee und Rüstung 66,8 Milliarden US-Dollar aus. Liegt es wirklich an der Menge des Geldes oder könnte es nicht sein, dass das Geld auch falsch eingesetzt wird? Wenn die französischen Streitkräfte die Verteidigungsfähigkeit mit weniger Geld herstellen können, warum nicht wir? Zumindest lohnte es sich, auch mal in dieser Richtung nachzudenken und die Strukturen zu untersuchen.
Und ein Problem ist und bleibt weltweit, dass die Rüstungsindustrie überwiegend privat ist und deshalb sehr viel an Rüstung und damit an Kriegen verdient wird. Wenn es uns gelänge, dass niemand mehr an Kriegen verdiente, wären wir dem weltweiten Friedensziel wesentlich näher.
Es gibt also unterschiedliche Auffassungen, wie man zum Frieden gelangt. Wir müssen einfach lernen zu respektieren, dass es diese Unterschiede gibt. Wenn wir mehr Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung erreichen wollen, sollten wir in unserer Sprache das Maß wahren, nicht immer bei Menschen mit anderer Auffassung das Übelste unterstellen. (…)
Wie wäre es mit einer breiteren politischen Kultur bei uns – so wie in Frankreich. Könnten einige Linke nicht aufhören, sich gegen die Benennung einer Straße nach Otto von Bismarck zu wenden? Kritik an ihm ist selbstverständlich erlaubt, aber er bleibt eine bedeutende historische Persönlichkeit. Und könnten sich nicht Konservative einen Ruck geben und unterstützen, eine Straße nach Clara Zetkin zu benennen. Eine Frau, die mutig gegen Armut und Elend und für eine Gleichstellung der Geschlechter kämpfte. Und übrigens, Karl Marx ist weltweit einer der bekanntesten Deutschen. Selbstverständlich darf auch er kritisiert werden. Aber er ist und bleibt ein großer Sohn unseres Volkes und man sollte wenigstens eine Universität nach ihm benennen, vielleicht die, die sich in seiner Geburtsstadt in Trier befindet. Das verpflichtet niemanden an der Universität, marxistisch zu werden, zumal Karl Marx, als der Begriff des Marxismus aufkam, erklärte, kein Marxist zu sein.
Gregor Gysi ging in seiner Rede am 25. März auf viele weitere Fragen ein. Dokumentiert beispielsweise unter www.freitag.de